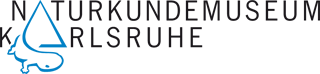Gefäßpflanzen, Moose und Flechten
Die Adelegg - Flora, Vegetation und Ethnobotanik einer mitteleuropäischen Gebirgslandschaft
Die Adelegg mit bis 1129 m Höhe, und einer Fläche von 112 km² ist eine heute v.a. bewaldete Gebirgslandschaft. Teile des Gebirgskamms Adelegg gehören zum 6,4 km² großen Fauna-Flora-Habitat-GebietAdelegg (FFH-Nr. 8326-341). Große Teile liegen im 68,14 km² großen LandschaftsschutzgebietAdelegg und zugehöriges tertiäres Hügelvorland (CDDA-Nr. 319441), sowie im Vogelschutzgebiet Adelegg (VSG-Nr. 8226-441).
Die Adelegg liegt nördlich der Allgäuer Voralpen und ist eine Übergangslandschaft zum Subalpinen Jungmoränenland. dabei ist die Region aber kein Ausläufer des alpinen Faltengebirges, sondern ein Teil eines Schwemmkegels in dem zwischen Alpen und Schwäbischer Alb sich erstreckenden Molassebecken, und wurde während der Alpenbildung nur unbedeutend aufgefaltet. Die konglomeratische Molasse der Adelegg besteht aus Nagelfluh, und gehört zur Oberen Süßwassermolasse die im Miozän von der Ur-Iller abgelagert wurde, und besteht v.a. als Material aus den südlichen Zentralalpen. Zur Adelegg gehören der in Baden-Württemberg gelegenen Gebirgszug Adelegg, und die in Bayern gelegenen Gebiete Hohentanner Wald, Kürnacher Wald, Buchenberger Wald und der Gebirgskamm Sonneneck.
Während heute Teile der Adelegg als Flora-Fauna-Habitat-Gebiet und Vogelschutzgebiet unter besonderem Schutz stehen, wurde das Massiv früher intensiv genutzt. Nach einer Besiedelung durch Benediktiner im Mittelalter folgten später eine große Zahl von Glashütten, die zur Produktion einen Großteil der Waldflächen rodeten. Auf diesen Kahlschlägen entwickelten sich artenreiche. Dieser Wechsel von Wäldern zu Almwiesen macht den besonderen Charakter der Adelegg aus. Der Gebirgszug ist Heimat von unzähligen Pflanzen- und Tierarten, zum Beispiel Gams oder Auerhahn. Die Adelegg wird heute vor allem forstwirtschaftlich und touristisch genutzt.
Die Adelegg ist Teil des Biodiversitäts Hotspots "Oberschwäbisches Hügelland und Adelegg", einer mit glazialen Becken, Seen und Mooren, durchsetzen Jungmoränenlandschaft mit zahlreichen Kuppen und Senken. Prägend für die Jungmoränenlandschaft ist der durch die Topografie bedingte kleinräumige Wechsel von Waldflächen (überwiegend Fichtenforste) und intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen (überwiegend Grünland, jedoch zunehmend Ackerbau), in die extensiv genutzte oder nicht genutzte Feuchtgebiete eingestreut sind. Dabei handelt es sich um Hoch- und Niedermoore mit Moorwäldern, Streuwiesen und Naßwiesen, sowie Quellmoore, Seen und Weiher, die durch Fließgewässer miteinander verbunden sind. Im Bereich der Adelegg selbst sind Steillagen mit extensiver Weidewirtschaft und z.T. sehr naturnahe montane Hangwäldern sowie Alpen in den Hochlagen landschaftsbestimmend. Insbesondere die totholzreichen Hangwälder und die Hochlagen begünstigen eine sehr artenreiche Avifauna.
Unser neues Projekt wird einerseits die Flora (Gefässpflanzen, Moose, Flechten, Pilze) und rezente Vegetation der Adelegg detailliert untersuchen, andererseits wird die Nutzung der pflanzlichen und pilzlichen Ressourcen über den Verlauf der Jahrhunderte dokumentiert, und dieses Wissen durch ethnobotanische und ethnomykologische Studien mit derzeitigen Adeleggbewohner*innen ergänzt. Dies dient einerseits der Dokumentation des historischen Wandels dem die Adelegg ausgesetzt war und des rezenten Globalen Wandels, andererseits wird dadurch die Grundlage für zukünftige Naturschutz und Entwicklungsmassnahmen geschaffen, nicht zuletzt im Hinblick auf eine mögliche Ausweisung des Gebiets als Biosphärenreservat.
Gefässpflanzen, Flechten und Moose Baden-Württembergs - Taxonomie, Verbreitung und Nutzung
Für das Referat Botanik am SMNK steht auch die Erforschung der heimischen Pflanzen und Pilze an vorderer Stelle. Diese Arbeiten haben seit Jahrzehnten zur wissenschaftlichen Erforschung Baden-Württembergs beigetragen und fanden ihren Niederschlag in einer Vielzahl umfangreicher Buchwerke.
Bereits 1987 erschien das Werk "Flechten Baden-Württembergs", gefolgt von einer Neuauflage 1995, als Gesamtdarstellung aller Flechten im Land, mit Verbreitungskarten und vollständigen Gattungsdiagnosen, Bestimmungsschlüsseln für sämtliche Arten, und Daten über Ökologie, Verbreitung und Gefährdung aller im Südwesten Deutschlands und weit darüber hinaus vorkommenden Flechtenarten. Das Artenschutzwerk "Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs" in acht Bänden folgte 1990. Das Werk beschrieb alle wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs mit ihren Merkmalen, Ökologie, Verbreitung und Schutzbedürftigkeit, und enthielt für jede Art eine Verbreitungskarte. In den Jahren 2000-2005 erschien dann die dreibändige Reihe "Moose Baden-Württembergs", und "Die Großpilze Baden-Württembergs", erschienen zwischen 2000-2010, schlossen das Inventar der Pflanzen und Pilze im Land ab. Viele der erschienenen Bände sind inzwischen vergriffen, oder nur zu exorbitanten Preisen antiquarisch erhältlich.
Während alle Werke eine herausragende Übersicht zu Taxonomie, Ökologie, Verbreitung und Gefährdung der behandelten Arten geben, fehlen jedoch jegliche Angaben zur Nutzung. Dies ist umso bedauerlicher, da wir inzwischen, mehr über Pflanzen weltweit, z.B., im Kaukasus, den Himalayas und den Anden wissen, als im Schwarzwald oder der Adelegg.
Dem soll abgeholfen werden. Unser neues Projekt "Gefässpflanzen, Flechten und Moose Baden-Württembergs - Taxonomie, Verbreitung und Nutzung" wird in den kommenden Jahren versuchen Information über historische, rezente und potenzielle zukünftige Nutzung ("lokales undtraditionelles Wissen") aller Gefässflanzen, Flechten und Moosarten in Baden-Württemberg zusammenzutragen.
Warum ist das wichtig?
Die Aufnahme traditionellen Wissens in das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt (1992) war ein grundlegender Meilenstein sowohl für die Anerkennung seines Wertes und seiner Bedeutung als auch für die Verdeutlichung seiner engen Beziehung zum Schutz und zur Nutzung der biologischen Vielfalt. Dieses Übereinkommen erkennt die enge Abhängigkeit an, die indigene und lokale Gemeinschaften mit biologischen Ressourcen haben, und legt fest, dass die Vertragsparteien traditionelles Wissen, das für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt relevant ist, respektieren, bewahren und fördern müssen.
Traditionelles Wissen wird als Informationsquelle für die Gestaltung von Umweltpolitiken im Zusammenhang mit Biodiversität angesehen. So werden im Rahmen der Intergovernmental Scientific-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) wissenschaftliche Erkenntnisse mit Daten von traditionellem Wissen ergänzt, um Maßnahmen zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der Biodiversität effektiver, verständlicher voranzutreiben. Hierzu sollte die Erstellung von Bestandsaufnahmen traditionellen Wissens zur Biodiversität breit gefördert werden.
Unser geplantes Inventar des traditionellen Wissens über die Biodiversität konzentriert sich auf traditionelles Wissen über Baden-Württembergs pflanzliche wilde Biodiversität. Das Inventar sammelt zuvor veröffentlichtes traditionelles Wissen aus Werken, in denen das Wissen durch direkte Datenerhebung erfasst wurde, z.B. durch Interviews vor Ort mit lokalen Teilnehmer*innen. Traditionelles Wissen ist dynamisch und hat diffuse Grenzen, d.h. es entwickelt sich immer weiter. Um Wissen zu bewahren, ist es dringend erforderlich, die Weitergabe von traditionellem Wissen an neue Generationen zu fördern.
Artenkenntnis für alle. Die Karlsruher Taxonomie-Initiative
Ein neues Projekt ist im Herbst 2022 angelaufen: Die „Karlsruher Taxonomie-Initiative“. Ziel des Projekts ist es, in der Region die Bildung im Bereich Artenkenntnis und Taxonomie von Pflanzen, Pilzen und Tieren zu stärken. Es ist am Naturkundemuseum Karlsruhe an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeitsarbeit und Bildung verankert und wird für drei Jahre durch die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg finanziert. Die Biologin Dr. Judith Bieberich ist für die Einrichtung und Etablierung dieses neuen Projekts verantwortlich.
Taxonomie ist die systematische Einteilung aller Lebewesen in Gruppen nach ihrer Verwandtschaft. In heutiger Zeit arbeitet sie mit vielfältigen klassischen und modernen Methoden, wie morphologischen Untersuchungen und genetischen Analysen. Taxonomie ist die Grundlage, um einen Überblick über die faszinierende Vielfalt an Lebewesen zu erhalten und Arten bestimmen zu können.
Artenkenntnis hat allerdings in den letzten Jahrzehnten stark nachgelassen. Viele Menschen kennen sich mit Pflanzen, Tieren und Pilzen nur geringfügig oder gar nicht aus und auch Fachleute mit wissenschaftlicher Expertise sind selten geworden. Einer der Gründe für diese Entwicklung liegt darin, dass Artenkenntnis und Taxonomie an Schulen und Universitäten nur noch wenig gelehrt wird, weil es durch molekularbiologische Fachrichtungen verdrängt wurde.
Aktuell wird die Wichtigkeit von Artenkenntnis zunehmend wieder neu entdeckt. Der Rückgang der Biodiversität ist eines der drängendsten Probleme des globalen Wandels und erfordert Naturschutzstrategien. Doch schon um die Gefährdung von Arten und den Erfolg von Schutzmaßnahmen beurteilen zu können, muss man die Arten erkennen können. Daher werden händeringend berufliche Fachkundige mit Artenkenntnis gesucht. Aber auch in der breiten Bevölkerung fördert eine Kenntnis der Natur deren Schutz: Was man kennt, das achtet und schützt man eher. Essentiell wird Artenkenntnis natürlich bei der Nutzung von Arten. So sollte man Pflanzen und Pilze nur dann sammeln und verzehren, wenn man sie sicher erkennen und bestimmen kann. Nicht zuletzt macht es auch einfach Freude, im Alltag bei einem Spaziergang Arten zu erkennen und darüber zu erfahren, wie sie leben, was sie können und welche Bedeutung sie für uns haben. Und Arten zu bestimmen kann eine richtige spannende Knobelei sein!
Im Rahmen der Karlsruher Taxonomie-Initiative sollen vielfältige Bildungsangebote zum Thema Artenkenntnis und Taxonomie ausgearbeitet und durchgeführt werden. Fachleute und Institutionen in diesem Bereich im Raum Nordbaden sollen untereinander noch besser vernetzt werden. So ist die Karlsruher Taxonomie-Initiative auch bereits mit der Initiative Integrative Taxonomie des Landes Baden-Württemberg vernetzt. Selbstverständlich wird es auch eine Zusammenarbeit mit dem sehr aktiven Naturwissenschaftlichen Verein Karlsruhe e.V. geben, der dem Naturkundemuseum eng verbunden ist.
Zu den Aufgaben des Naturkundemuseums Karlsruhe als öffentliche Biodiversitäts-Forschungseinrichtung gehört auch, als Ansprechpartner für Behörden sowie für die Bevölkerung Unterstützung in Natur- und Umweltschutzfragen zu bieten. So werden schon seit Langem Bestimmungsanfragen beantwortet. Diese Funktion als Anlaufstelle, an die sich Interessierte mit Fragen zu Arten und deren Bestimmung wenden können, soll im Rahmen der Karlsruher Taxonomie-Initiative gestärkt und verbessert werden.
Das Naturkundemuseum Karlsruhe bietet beste Bedingungen für ein solches Projekt: Sein wissenschaftliches Personal der Abteilungen Bio- und Geowissenschaften besitzt die selten gewordenen Artenkenntnisse. Des Weiteren wird am Museum eine vielfältige Natur- und Umweltbildung einschließlich der Grundlagen der Artenkenntnis geleistet. Als eines der großen Forschungsmuseen Deutschlands unterhält das Naturkundemuseum Karlsruhe auch bereits intensive Kontakte zu weiteren Fachleuten und Einrichtungen im Bereich Umweltbildung. Ideale Voraussetzungen für den Start der Karlsruher Taxonomie-Initiative!
Sammlungen, Digitalisierung, Naturschutz und Globaler Wandel
Ein Rückgang botanischer Sammlungen und Sammlungsinteressen in den letzten Jahrzehnten ist höchst problematisch. In einer Zeit des schnellen Klimawandels enthalten botanische und andere naturkundliche Sammlungen wertvollere Daten zum Verständnis langfristiger Veränderungen und zur Unterstützung des Naturschutzes. Die Stärkung der Sammlung, Kuration und Datenverfügbarkeit (Digitalisierung) ist ein vorraginges Ziel des Referats Botanik am SMNK.
Pflanzen sind lebensnotwendige Organismen. Sie produzieren Sauerstoff, erhalten die Bodenqualität und bieten anderen Organismen Nahrung und Lebensraum. Sie können die Luftverschmutzung reduzieren, haben medizinische Eigenschaften und binden CO2 aus der Atmosphäre. Sie sind überall um uns herum, können schön sein und sind tief in Kulturen weltweit eingebettet. Doch die Menschen wollen Pflanzen nicht studieren, und tatsächlich werden die vielfältigen Rollen, die Pflanzen in unserem täglichen Leben spielen, weitgehend unterschätzt.
Das mangelnde Interesse an der Botanik ist ein hartnäckiges Problem, und unsere eigenen Erfahrungen bestätigen dies. Wenn wir Studenten nach ihren Interessen fragen, hören wir oft: „Alles außer Pflanzen!“. Dass die Öffentlichkeit und auch die breitere wissenschaftliche Gemeinschaft oft nicht wissen, was moderne Botanik und ihre wichtigsten Errungenschaften sind, wurde bereits in den 1960er Jahren festgestellt. Sogar unter Pflanzenbiologen selbst hat der Begriff „Botanik“ an Gunst verloren, hauptsächlich aufgrund seiner wahrgenommenen historischen und taxonomischen Konnotationen. Pflanzentaxonomie und -bestimmung, eine Fähigkeit, die oft mit Botanikern in Verbindung gebracht wird, fehlt es oft an angemessener wissenschaftlicher und professioneller Anerkennung. Parallel zu diesem Trend in der Wissenschaft sind das öffentliche Wissen über Pflanzen und das Interesse am Studium der Pflanzenwissenschaften zurückgegangen. Die möglichen Ursachen sind komplex, aber Faktoren, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen, Diskrepanzen zwischen unserer Wahrnehmung von Verhalten, Handlungsfähigkeit und Individualität bei Pflanzen und Tieren sowie die Trennung von landwirtschaftlichen und natürlichen Umgebungen spielen eine wichtige Rolle. Das kann in Zukunft schlimme Folgen haben.
Aufgrund des abnehmenden Interesses an Botanik als wissenschaftlicher Disziplin sind selbst hochqualifizierte Biologen oft nicht in der Lage, gewöhnliche Pflanzen zu identifizieren. Darüber hinaus leiden Pflanzenidentifikationsfähigkeiten unter mangelnder wissenschaftlicher Anerkennung und Botaniker laufen Gefahr auzzusterben. Eine unzureichende Aufnahme von Abschlüssen in Botanik und Pflanzenwissenschaften kann zu einem allmählichen Rückgang des Fachwissens in Bereichen führen, die für die Ernährungssicherheit von wesentlicher Bedeutung sind, wie z. B. Pflanzenpathologie.
Beispiel – Erhaltung von Heilpflanzen in China
Heilpflanzen haben in der Geschichte der menschlichen Gesundheit schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Die Populationen und die nachhaltige Nutzung von Heilpflanzen wurden jedoch durch menschliche Aktivitäten und den Klimawandel stark beeinträchtigt. Über den aktuellen Erhaltungszustand und Verbreitungsmuster von Heilpflanzen ist wenig bekannt. In einer Studie in China identifizierten wir auf der Grundlage genauer geografischer Verbreitungsinformationen von 9756 Heilpflanzen Diversitäts-Hotspots und Erhaltungslücken, bewerteten die Erhaltungswirksamkeit von Naturschutzgebieten und prognostizierten geeignete Lebensräume für Heilpflanzen in China, um wissenschaftliche Leitlinien für ihre lange Lebensdauer bereitzustellen Laufzeiterhaltung und nachhaltige Nutzung. Basierend auf digitalen Daten von Pflanzensammlungen in China wurden insgesamt 150 Diversity-Hotspot-Gitterzellen identifiziert, die sich hauptsächlich auf Zentral- und Südchina konzentrieren. Diese machten nur 5 % des gesamten Verbreitungsgebiets aus, enthielten aber 96 % der Heilpflanzen des Landes. Die Hotspot-Rasterzellen umfassten alle traditionellen Hotspot-Gebiete, aber wir entdeckten auch drei neue Hotspots, nämlich das Mufu-Lushan-Gebirge, das Tianshan-Altai-Gebirge und das Changbai-Gebirge. Die aktuellen nationalen und provinziellen Naturschutzgebiete schützen 125 Hotspot-Rasterzellen, die 94 % aller Heilpflanzen beherbergen. 25 Hotspot-Gitterzellen, die im Tianshan-Altai-Gebirge und im Hengduan-Gebirge verteilt sind, befinden sich jedoch außerhalb der nationalen und provinziellen Naturschutzgebiete. Eine Analyse der prognostizierten Auswirkungen des Klimawandels ergab, dass sich die geeigneten Habitatgebiete von Süd- nach Nordchina verlagern werden und dass Südchina mit einem erheblichen Verlust an geeigneten Habitatgebieten konfrontiert sein wird, während die östlichen und westlichen Teile Chinas deutlich besser geeignete Gebiete als Lebensräume in der Zukunft umfassen. In China haben aktuelle Schutznetzwerke eine hohe Schutzwirksamkeit in Bezug auf Heilpflanzen erreicht. Die von uns identifizierten Erhaltungslücken sollten jedoch nicht vernachlässigt werden, und die Erhaltungsplanung muss die prognostizierten Verschiebungen einiger Hotspots von Heilpflanzen aufgrund des Klimawandels berücksichtigen.
Gastronomische Ethnobotanik
Menschen sind auf Pflanzen als Nahrung angewiesen, nutzen sie als Baumaterial und zur Herstellung ihrer täglichen Werkzeuge; Sie bilden auch einen wichtigen Teil ihrer kulturellen und spirituellen Praktiken. 80 % der Bevölkerung in den Entwicklungsländern ist für ihre primäre Gesundheitsversorgung auf Pflanzen angewiesen. Indigene Gruppen nutzen Pflanzen in ihrem täglichen Leben auf vielfältige Weise. In vielen Kulturen wird das traditionelle Wissen über die Verwendung von Pflanzen von Generation zu Generation hauptsächlich auf mündlichem Weg weitergegeben. Indigene und lokale Gesellschaften sind zunehmend mit Veränderungen konfrontiert, die die Bewahrung ihres traditionellen Wissens bedrohen. Es wird geschätzt, dass die meisten der weltweit gesprochenen Sprachen in den nächsten 50 Jahren verschwinden werden.
Es gibt etwa 10000 Arten essbarer Pflanzen, aber nur etwa 100 Arten gehören zu den Pflanzen, die von der großen Mehrheit der Welt konsumiert werden, und weniger als 10 Arten liefern mehr als 90 % der weltweit verbrauchten Kalorien. Die große Vielfalt an Pflanzen, die auf der Welt wachsen, wurde kaum für mögliche alternative Nutzpflanzen und als Quelle genetischer Ressourcen genutzt, die dazu beitragen könnten, die heute am häufigsten verwendeten Nahrungspflanzen zu verbessern.
Wir arbeiten auf der ganzen Welt, um die kulinarische Kultur und lokale Ernährungssysteme zu dokumentieren und die globale Nahrungsmittelvielfalt zu erhalten und zu fördern. Als Teil unserer Mission helfen wir, die Zutaten vom Feld und vom Bauernhof auf den Tisch von gehobenen Restaurants zu bringen.
Medizinalpflanzen und pflanzliche Lebensmittelinhaltsstoffe im 21. Jahrhundert - Nutzen und Sicherheit
Das globale Inventar der Pflanzenvielfalt besteht derzeit aus etwa 350.000 Arten, wobei die meisten aktuellen Schätzungen von etwa 420.000 Pflanzenarten ausgehen. Diese enorme Vielfalt erklärt eine breite Palette von sekundären Pflanzenstoffen und eine große Variation der Zusammensetzung der Verbindungen selbst innerhalb einer einzigen Art, abhängig von den Wachstumsbedingungen (Boden, Klima, Nährstoffstatus usw.) und Erntepraktiken und -zeitpunkt, nicht einmal unter Berücksichtigung intraspezifischer Variationen berücksichtigen. Während die traditionelle Pflanzenverwendung und Medizinzubereitung diese Details normalerweise berücksichtigt, werden sie im Kräuterhandel oft als marginal angesehen. In den USA sollen botanische Nahrungsergänzungsmittel gekennzeichnet werden, mit der Anforderung, den korrekten wissenschaftlichen Namen anzugeben. In der Praxis verhindert dies jedoch nicht zufällige oder vorsätzliche Verfälschungen oder kann Schwermetallverunreinigungen enthalten. Das problematischste Ereignis im Handel mit pflanzlichen Arzneimitteln ist jedoch der Kauf und die Verwendung von pflanzlichen Stoffen, entweder in der Medizin oder in der Forschung, die entweder versehentlich oder absichtlich falsch identifiziert oder einfach unter einem einheimischen Namen ohne anschließende taxonomische Behandlung und oft ohne gesammelt werden Belegmaterial zu haben, das später für die Überprüfung der Pflanzenidentität verwendet werden könnte. In der Literatur wurde häufig über den Ersatz üblicher, nicht toxischer Arten durch toxische Arten berichtet. Gute Beispiele für lebensgefährliche Verfälschungen sind der Ersatz von Plantago major L. durch Digitalis lanata Ehrh., Illicium verum Hook. f. B. mit Illicium anisatum L., oder Arctium lappa L. mit Atropa belladonna L. Viel häufiger kommt es jedoch vor, dass oft bewusst Pflanzen mit gebräuchlicheren und billigeren Arten verfälscht werden, die zwar im Allgemeinen nicht toxisch sind, aber möglicherweise völlig unwirksam sind. Unverarbeitete Massenkräuter sind leicht verfügbar, was die Aufbewahrung von Material für einen botanischen Gutschein ermöglicht, obwohl Handelsmaterial oft nicht alle Pflanzenteile enthält, d schwer. Rohe Botanicals werden dagegen oft auch in gemahlener oder pulverisierter Form angeboten, was eine morphologische Identifizierung sehr schwierig oder praktisch unmöglich macht. Während mikroskopische und organoleptische Methoden es manchmal ermöglichen, die richtigen Arten von Verfälschungsmitteln zu trennen, ist eine solche Identifizierung von pulverförmigem Material oder Extrakten unmöglich, wenn das Material nur zerkleinert oder sehr grob gemahlen wird. Aus diesem Grund besteht die einzige Möglichkeit, die Quelle eines bestimmten Botanicals später sicher zu identifizieren, darin, auf botanische Belegexemplare zu setzen, die direkt mit dem Material im Handel in Verbindung gebracht werden können. Hier spielen Pflanzentaxonomie und ausgebildete Taxonomen eine unersetzliche Rolle in der Kräuterergänzungsindustrie. Die Notwendigkeit des Einsatzes botanischer Methoden in der Ethnopharmakologie ist keineswegs neu, und seit Jahrzehnten werden Forderungen von Botanikern nach einer breiteren Einbeziehung der botanischen Taxonomie in die Disziplin veröffentlicht. Ebenso wurde häufig dokumentiert, dass sich die einheimischen Namen für Arten dramatisch ändern können.
Beispiel 1 - nicht einmal die Grasart, die für die häufigsten Körbe in Madagaskar verwendet wird, war wissenschaftlich korrekt bekannt.
Madagaskar birgt eine große Vielfalt an Vegetation und endemischen Arten. Die Insel besteht aus einer Vielzahl natürlicher Ökosysteme, die eine einzigartige und weltweit bedeutende Flora beherbergen. Körbe aus Pflanzenfasern sind in ganz Madagaskar ein alltäglicher Anblick und spielen auch im internationalen fairen Handel eine wichtige Rolle. Jede Online-Suche nach Körben aus Madagaskar führt zu einer großen Anzahl von Verkaufsseiten. Körbe sind in der madagassischen Wirtschaft seit langem wichtig. Während die madagassische Flora eine enorme Vielfalt aufweist, werden die meisten im Handel erhältlichen Körbe aus Fasern der Raphia-Palme (Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl, Arecaceae) hergestellt, wobei andere Palmenarten zum Korbportfolio beitragen. In Zentral-Madagaskar bestehen jedoch die Körbe, die lokal verwendet und auf Märkten in der Hauptstadt Antananarivo verkauft werden, fast ausschließlich aus Gras und sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Das verwendete Grasmaterial ist lokal als "Harávola" bekannt. Zu unserem großen Erstaunen wusste keiner der Mitarbeiter des Missouri Botanical Garden in Madagaskar, welche Grasarten verwendet wurden oder wurden, um diese Körbe und einige andere Utensilien herzustellen, die auf lokalen Märkten zu sehen sind. Basierend auf einer Literaturrecherche wurde eine erste Erwähnung von Grasmaterial, das in der Herstellung verwendet wurde, in einem Bericht über Madagaskar-Wirtschaftspflanzen aus dem Royal Botanical Garden Kew gefunden, wo Stipa madagascariensis Baker (akzeptierter Name: Loudetia simplex ssp. stipoides Bosser) als „Für einheimische Körbe und Hüte." Die vollständigste Checkliste der Gräser von Madagaskar erwähnte keine Verwendung für Loudetia sp. aber beschrieb Lasiorhachis viguieri (A. Camus) Bosser als „Les feuilles sont utilisées en vannerie et servent à tresser des chapeaux et des paniers“ – Die Blätter werden in der Korbmacherei verwendet und dienen zum Weben von Hüten und Körben. In der Literatur waren jedoch keine detaillierten Beschreibungen von Artefakten oder Bilder verfügbar, um anzuzeigen, welche Art für was verwendet wurde. Basierend auf dem Aussehen der Artefakte stellten wir die Hypothese auf, dass mehrere Grasarten an der Herstellung von Körben und Utensilien beteiligt waren.
Beispiel 2 – Viele verschiedene Arten werden als Lorbeerblatt verkauft!
Die genaue Identifizierung des Lorbeerblatts im Handel mit Naturprodukten kann oft verwirrend sein, da der Name für mehrere verschiedene Arten aromatischer Pflanzen verwendet wird. Das echte „Lorbeerblatt“, auch „Lorbeer“ oder „Süßer Lorbeer“ genannt, wird aus dem im Mittelmeerraum beheimateten Baum Laurus nobilis gewonnen. Dennoch werden die Blätter mehrerer anderer Arten, darunter Cinnamomum tamala, Litsea glaucescens, Pimenta racemosa, Syzygium polyanthum und Umbellularia californica, aufgrund ihrer Ähnlichkeit in Blattmorphologie, Aroma und Geschmack häufig mit echten Lorbeerblättern ersetzt oder verwechselt. Ersatzarten werden jedoch oft als „Lorbeerblätter“ verkauft. Daher kann sich der Name „Lorbeerblatt“ in der Literatur und im Kräuterhandel auf alle diese Pflanzen beziehen. Der Geruch und Geschmack dieser Blätter ist jedoch nicht derselbe wie der echte Lorbeer, und aus diesem Grund sollten sie beim Kochen nicht als Ersatz für L. nobilis verwendet werden. Einige der Lorbeerblatt-Ersatzstoffe können auch potenzielle Gesundheitsprobleme verursachen. Daher ist die korrekte Bestimmung des echten Lorbeerblattes wichtig. Die vorliegende Arbeit bietet eine detaillierte vergleichende Studie der blattmorphologischen und anatomischen Merkmale von L. nobilis und seiner gemeinsamen Surrogate, um eine korrekte Identifizierung zu ermöglichen.
Beispiel 3 – Viele verschiedene und verwirrte Arten werden als Antidiabetika verkauft
Peru ist, wie der peruanische Anthropologe Lupe Camino nennt, die „Gesundheitsachse“ des alten Kulturgebiets der zentralen Anden, das sich von Ecuador bis Bolivien erstreckt. Insbesondere im Norden des Landes reicht die traditionelle Verwendung von Heilmitteln bis ins erste Jahrtausend v. Chr. zurück. Sowohl Heiler als auch die breitere Bevölkerung kaufen ihre Heilpflanzen oft auf lokalen Märkten, aber es gibt nur sehr wenige vergleichende Informationen darüber, welche Pflanzen zu welchem Zeitpunkt, für welche Indikation und zu welcher Dosierung und zu welchen Dosierungen verkauft werden Nebenwirkungen wird von den Anbietern angegeben. Für diese Studie haben wir zwei traditionell genutzte Artengruppen „Hercampuri“ Gentianella spec. (Gentianaceae) und „Pasuchaca“ Geranium spec. (Geraniaceae.), gefunden im Mercado Aviación in Lima, als kleine, klar umschriebene Pflanzengruppe, die häufig zur Behandlung von Diabetes-Symptomen verwendet wird, als Testfall zur Untersuchung der Taxonomie, Indikationen, Dosierung, angezeigten Nebenwirkungen und weiterer Arten, die als Beimischungen verwendet werden und stellte die Hypothese auf, dass: 1. Eine Vielzahl unterschiedlicher Arten unter demselben gebräuchlichen Namen verkauft wird und häufig mehrere gebräuchliche Namen für eine Art existieren. 2. Es gibt keine Konsistenz in der Dosierung oder eine Beziehung zwischen Dosierung und Art, die unter einem Namen vermarktet wird. 3. Das Wissen über Anwendung und Nebenwirkungen ist jedoch konsistent. Unsere Untersuchungen im Mercado Aviación in Lima ergaben vier Arten von Gentianella, zwei von Geranium und drei weitere Arten aus drei Gattungen, die als übliche Zusatzstoffe verwendet und als Antidiabetika verkauft wurden. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass Patienten selbst bei wenigen Pflanzenarten, die für eine sehr klar umschriebene Anwendung verwendet werden, ein erhebliches Risiko eingehen, wenn sie ihre Arzneimittel auf dem Markt kaufen. Die möglichen Nebenwirkungen sind in diesem Fall umso gravierender, als der Diabetes langfristig behandelt werden muss und die Patienten daher über einen langen Zeitraum mögliche toxische Mittel einnehmen. Es wäre viel mehr Kontrolle und eine viel strengere Identifizierung des Materials erforderlich, das auf öffentlichen Märkten verkauft wird und über den Internetverkauf in die globale Lieferkette gelangt.
Beispiel 4 – Verwendung von Pflanzen zur Behandlung von COVID-19.
Pflanzen sind die Grundlage des Lebens auf der Erde, wie wir es kennen, und das Studium der Pflanzen ist unerlässlich, um unsere Zukunft zu schützen. Die Sicherung unserer Zukunft erfordert den Schutz der pflanzlichen Biodiversität und die Entwicklung klimaresistenter Nutzpflanzen. Eine verstärkte wissenschaftliche Kommunikation über aufregende Fortschritte in unserem Wissen über Pflanzen und ihre Bedeutung für die Gesellschaft könnte eine Strategie sein, um dem entgegenzuwirken. Jüngste Studien zeigen, dass die COVID-19-Pandemie das Bewusstsein für den therapeutischen Wert der Interaktion mit Pflanzen und ihre positive Wirkung auf das menschliche Wohlbefinden gestärkt hat.
In einer sehr komplexen und verwirrenden Zeit, in der die öffentlichen Gesundheitsdienste in mehreren Ländern völlig überfordert und in einigen Fällen sogar zusammengebrochen waren, waren diese ersten Maßnahmen der Haushalte für den Aufbau der körperlichen, geistigen und sozialen Widerstandsfähigkeit und für die Verbesserung von entscheidender Bedeutung individuelle und gemeinschaftliche Gesundheit. Städtische Diasporas und ländliche Haushalte scheinen hausgemachte Heilmittel auf pflanzlicher Basis wiederverwendet zu haben, die sie in normalen Zeiten zur Behandlung der Grippe und anderer Atemwegssymptome verwenden oder die sie einfach als gesunde Lebensmittel betrachten. Die bemerkenswerteste Veränderung in vielen Bereichen war der erhöhte Konsum von Ingwer und Knoblauch, gefolgt von Zwiebeln, Kurkuma und Zitrone. Unsere vorläufige Bestandsaufnahme von Lebensmittelarzneimitteln dient als Grundlage für zukünftige systematische ethnobotanische Studien und zielt darauf ab, eingehende Forschung darüber anzuregen, wie sich die Nutzungsmuster pflanzlicher Lebensmittel und Getränke, sowohl „traditioneller“ als auch „neuer“, während und nach dem verändern Covid19 Pandemie. Wir lenken die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Ethnobiologie, Ethnomedizin und Ethnogastronomieforschung für Strategien der häuslichen Gesundheitsversorgung zur Verbesserung der Gesundheit der Gemeinschaft.
Der Kaukasus - Flora, Vegetation und Ethnobotanik
Nur wenige Regionen in Europa sind tiefer von Mythologie durchdrungen als der Kaukasus, und wenige haben mehr Interesse bei Botanikern und Anthropologen gleichermaßen geweckt. Angesichts der historischen, kulturellen, wirtschaftlichen, religiösen und ethnischen Vielfalt der Region wäre es in der Tat unmöglich, den Kaukasus mit einem einzigen Begriff zu definieren.
Die Gebirgszüge des Großen und Kleinen Kaukasus bilden einen der wichtigsten Biodiversitäts-Hotspots und auch eine Wiege für die Nutzung menschlicher Pflanzen, wo die menschliche Landwirtschaft mindestens 9000 Jahre zurückreicht, mit einer erstaunlichen menschlichen Vielfalt. Der griechische Historiker Herodot schrieb im 5. Jahrhundert v. Chr., dass „viele und alle Arten von Nationen im Kaukasus wohnen“, und Strabon berichtete zu Beginn des ersten Jahrhunderts n. Chr. von 70 „Stämmen“ in der Region, von denen jeder seine eigenen hatte eigene Sprache. Der römische Chronist Plinius der Ältere schrieb, dass die Römer 130 Dolmetscher brauchten, um im Kaukasus Geschäfte zu machen. Die Sprachfamilien Armenisch und Kartwelisch (zu denen Georgisch gehört) gehören zu den ältesten der Welt.
Diese unglaubliche Vielfalt und die Bedeutung der Region z.B. als Durchgangsgebiet für die Seidenstraße, spiegelt sich auch in der Nutzung von Pflanzen wider, und während viele Arten in verschiedenen Teilen des Kaukasus gemeinsam genutzt wurden, haben Menschen auch eine breite Palette unterschiedlicher Arten entwickelt, pflanzliche Ressourcen zu nutzen, sei es als Nahrung , Medizin oder Utensilien und Werkzeuge.
Die Kombination aus einer Vielzahl von Ökosystemen, die eine enorme botanische Vielfalt fördern, zusammen mit alten Pflanzennutzungspraktiken und der atemberaubenden Gastfreundschaft seiner Völker, macht den Kaukasus zu einem Traumziel für Ethnobotaniker. Während die ethnobotanische Forschung in der Region im frühen 20. Jahrhundert ziemlich prominent war, wurde seit den 1940er Jahren nur wenig Forschung auf diesem Gebiet aus der Region veröffentlicht. Angesichts des Fehlens neuerer Veröffentlichungen zur menschlichen Pflanzennutzung im weiteren Kaukasus ist der vorliegende Band eine sehr aktuelle Zusammenstellung der wichtigsten Wildpflanzenarten, die in Armenien, Aserbaidschan und Sakartvelo (Republik Georgien) verwendet werden.
Ethnobotanik im georgischen Kaukasus
Das Gebiet des heutigen Georgiens ist seit der frühen Steinzeit ununterbrochen besiedelt, und die Landwirtschaft wurde während der frühen Jungsteinzeit entwickelt. Auf Georgisch ist der Name des Landes "Sakartvelo", und "Georgia" ist semantisch mit dem Griechischen (γεωργία) verbunden, was "Landwirtschaft" bedeutet. Die menschliche Besetzung begann jedoch im frühen Pleistozän. Die 1,7 Millionen alten Hominidenfossilien von Dmanisi in Südgeorgien sind die frühesten bekannten Hominidenfunde außerhalb Afrikas. Dieses Exemplar wurde als spätmittelpaläolithisch und frühoberer Neandertaler klassifiziert, und die moderne menschliche Besiedlung ist gut dokumentiert. Jungpaläolithische Fossilien der Dzudzuana-Höhle umfassen Überreste von Wolle (Capra caucasica) und gefärbte Fasern von wildem Flachs (Linum usitatissimum L.), die auf ~ 36–34 Ka BP datiert werden.
Der Kaukasus gilt als einer der globalen Biodiversitäts-Hotspots, und Georgien hat seinen gerechten Anteil an der enormen Vielfalt der Region. Die botanische Erforschung des Kaukasus hat eine lange Geschichte, die zu guten neueren Behandlungen der Vegetation des Gebiets geführt hat, insbesondere im Hinblick auf Georgien. Als solches war Georgien lange Zeit das Zentrum der botanischen Erforschung im Kaukasus, wobei der Bakuriani Alpine Botanic Garden als Drehscheibe diente. Das Besucherprotokoll des Gartens liest sich wie das „Who is Who“ der Botanik des 20. Jahrhunderts.
Die archäologischen Funde aus der Jungsteinzeit und der frühen Bronzezeit sind reich an Pflanzenfossilien und Samen von Wildarten und lokalen Landrassen. Sieben Arten von Kulturweizen - Triticum aestivum L., T. carthlicum Nevski, T. compactum Host, T. dicoccum Schrank, T. macha Dekapr. & Menabde, T. monococcum L., T. spelta L., ein wilder Verwandter, Aegilops cylindrica Host., sowie Hirse - Panicum milliaceum L., Gerste - Hordeum vulgare L., Italienische Hirse - Setaria italica L.) P B. Beauv., Hafer – Avena sativa L., wilde Linse – Lens ervoides (Brignolidi & Brunhoff) Grande und Erbse – Pisum sativum L. wurden in Arukhlo entdeckt, die auf das 6. bis 2. Jahrtausend v. Die frühesten Weinrebensamen, die auf eine Kultivierung hindeuten, wurden in Südgeorgien ausgegraben und datieren auf etwa 8.000 Jahre vor Christus. Die Landwirtschaft in Georgien zeichnet sich aufgrund ihrer langen Tradition durch eine große Vielfalt an Landrassen und endemischen Nutzpflanzenarten aus. Diese weisen eine hohe Anpassungsfähigkeit an lokale klimatische Bedingungen und eine oft hohe Krankheitsresistenz auf. Frühe Forschungen dokumentierten diese große Vielfalt, aber mit der stalinistischen Agrarreform begann in den 1950er Jahren ein rascher Verlust lokaler Getreidesorten, Hülsenfrüchte und Flachs. Trotz der langen Kulturgeschichte sind neuere Studien zu Kulturpflanzen eher rar.
Georgien gilt als eine der ältesten christlichen Regionen und nahm das Christentum um 320 n. Chr. an. Ein großartiges Beispiel für den frühen Kirchenbau ist die im 14. Jahrhundert erbaute Gergeti Trinity Church, die sich auf 2170 m am Fuße des Berges Kazbeghi (5047 m) befindet und das enge Tal überblickt, das von Georgien nach Inguschetien führt. Ahnenschreine sind jedoch in vielen Regionen Georgiens immer noch sehr verbreitet.
Weintrauben - Vitis vinifera L. (Vitaceae) weisen in Georgien eine genetische Vielfalt auf, mit etwa 500 bekannten Sorten, und in den meisten Regionen ist die Bevölkerung sehr stolz darauf, ihren eigenen Wein zu produzieren und ihn mit Besuchern zu teilen. Kaum ein Haus im georgischen Tiefland steht ohne wenigstens ein paar Trauben im Garten oder Hinterhof. Heute werden in Georgien einundvierzig Weinrebensorten als kommerzielle Sorten verwendet, und guter Wein ist leicht erhältlich, aber die Geschichte des Weinanbaus und der Weinherstellung reicht Jahrtausende zurück. Wie in anderen Teilen Europas wurden die georgischen Trauben von der Reblaus verwüstet, und nach dem Befall in den 1860er Jahren werden die meisten georgischen Rebsorten jetzt auf Unterlagen von amerikanischen Rebsorten gepfropft, die gegen die Reblaus resistent sind.
Weizen - Triticum L. (Poaceae): In den 1940er Jahren wurden in Georgien sechzehn Arten, 144 Varietäten und 150 Weizenformen registriert (Menabde 1948). Diese Vielfalt hat jedoch stark abgenommen und die meisten Arten waren bereits in den 1960er Jahren verschwunden, als eingeführte Sorten in sowjetischen Kolchossystemen bevorzugt wurden. Derzeit wird keine dieser Arten in der georgischen kommerziellen Landwirtschaft ausgesät.
Gerste – Hordeum vulgare L. (Poaceae) ist ebenfalls eine alte landwirtschaftliche Nutzpflanze in Georgien und hatte eine besondere Bedeutung in der Bierherstellung sowie eine Funktion in religiösen Ritualen und der traditionellen Medizin.
Roggen – Secale cereale L. (Poaceae) wurde früher in den Hochgebirgsregionen Georgiens (1800-2200 m) angebaut und fand Eingang in die Brot- und Bierproduktion, obwohl Gerste für Bier bevorzugt wurde.
Bedrohungen für die Vielfalt
Der Prozess der genetischen Erosion alter Kulturpflanzenarten war ursprünglich von geringer Bedeutung für die Berggebiete Georgiens, die bis in die 1990er Jahre als Aufbewahrungsort alter Kulturpflanzen dienten. Heutzutage ist der Hauptgrund für die genetische Erosion alter Kulturpflanzen der demografische Rückgang in den Bergregionen aufgrund der harten wirtschaftlichen Bedingungen und des Mangels an moderner Infrastruktur. Die Verlagerung von alten Kultursorten hin zu modernen Hochertragskulturen wie Mais und Kartoffeln, die im Flachland viel früher stattfand, begann in den Bergdörfern nach dem Ende der sowjetischen Besatzung, als die ins Flachland vertriebenen Einheimischen zurückkehrten in ihre ursprünglichen Dörfer. Viele Dörfer im hoch gelegenen Georgien wurden jedoch während der sowjetischen Besatzung unter Druck aufgegeben, und während einige Familien zumindest für den Sommer zurückgekehrt sind, wurden viele Dörfer in den 1980er Jahren vollständig verlassen und liegen in Trümmern. Während zu Sowjetzeiten in großem Umfang Schafe gezüchtet wurden, was zu einer weit verbreiteten Überweidung führte, sind heute nur noch wenige verstreute Herden übrig, und traditionelle Wollartikel sind immer schwieriger zu finden. Leider konnten wir nirgendwo Getreideanbau finden, obwohl alte Landrassen von Weizen und Gerste früher bevorzugt verwendet wurden, um Brot und Bier für religiöse Rituale zu bereiten.
Botanischer Alpengarten Bakuriani
Kürzlich hat der Bakuriani Alpine Botanic Garden ein ethnobotanisches Forschungsprogramm gestartet, das die gesamte Republik Georgien abdeckt. BABG mit seiner zentralen Lage in Georgien, insbesondere in Bezug auf die wichtigsten Regionen traditioneller Nutzung (Ajaria, Swanetien, Tuschetien), wird einerseits als ethnobotanisches Bildungs- und Ressourcenzentrum fungieren und andererseits eine ethnobotanische Gartenabteilung aufbauen zur In-situ-Erhaltung traditionell im Kaukasus verwendeter Pflanzen sowie als Lehrgarten dienen. Es werden Feldexpeditionen organisiert, um lebendes Pflanzenmaterial und Samen von Heilpflanzen für die Ex-situ-Konservierung an zuvor vorbereiteten Standorten in der Alpine Botanical zu sammeln. Basierend auf Literatur und Feldbeobachtungen wird eine Rote Liste gefährdeter Heilpflanzenarten erstellt. Die Projektarbeit erfolgt in enger Zusammenarbeit und Beteiligung von lokalen Gemeindevertretern und Interessengruppen. Mit der regionalen Nichtregierungsorganisation "Tskhratskaro" in Bakuriani werden enge Kontakte geknüpft, um das Wissen über Heilpflanzen unter Schulkindern und Jugendlichen zu verbreiten. Poster mit georgischen seltenen Heilpflanzen werden gedruckt und an die lokale Bevölkerung verteilt.
Fläche: Die Gartensammlungen nehmen ca. 6 ha ein. Der Großteil der Sammlungen wird im Alpensteingarten gepflegt. Derzeit unterstützt der Garten 94 endemische Arten des Kaukasus, darunter 32 georgische Endemiten. Darüber hinaus umfassen die Gartensammlungen 77 seltene und 55 gefährdete Pflanzenarten. Zum Garten gehört ein 10 ha großes Stück Urwald aus Fichten, Kiefern und Buchen. Der Wald ist von entscheidender Bedeutung für den Erhalt dieses Waldökosystems, da er einer der letzten Reste der regionalen Primärwälder ist, 15 ha traditionell genutzter Mähwiesen.
Ethnobotanik und Ethnozoologie im Himalaya - Indien, Nepal, Pakistan
Die Himalaya-Region birgt einen Großteil der biologischen und kulturellen Vielfalt der Welt. Diese Vielfalt strukturiert sich nicht nur über das steile Nord-Süd-Höhengefälle, sondern auch über ein Ost-West-Gefälle der Niederschläge. Tausende von Pflanzen und Tieren werden gemeinsam als Medizin, Lebensmittel, Futter, religiöse Zwecke usw. verwendet. Besonders in Berggemeinden sind diese Nutzpflanzen lebenswichtig, in einigen Gebieten werden sie von praktisch allen Haushalten gesammelt und stellen die Hälfte des Haushaltseinkommens
Die dialektische Beziehung zwischen indigenem Wissen und Praktiken prägt das Ökosystem und wirkt sich auf die Pflanzenpopulationen aus. Indigenes Wissen und indigene Nutzung müssen explizit analysiert werden, damit geeignete Managementmaßnahmen entwickelt werden können, die sowohl auf wissenschaftlichem als auch auf lokalem Wissen aufbauen, um sowohl indigenes Wissen als auch Pflanzenpopulationen zu verwalten. Aufgrund der veränderten Wahrnehmung der lokalen Bevölkerung, der Kommerzialisierung und des sozioökonomischen Wandels auf der ganzen Welt wurde jedoch allgemein beobachtet, dass das indigene Wissen über die Nutzung pflanzlicher Ressourcen abgenommen hat. Aufgrund des Mangels an organisiertem und wissenschaftlichem Anbau, ordnungsgemäßem Management und Bewusstsein für soziale Faktoren nimmt die Anzahl nützlicher Pflanzenressourcen mit alarmierender Geschwindigkeit ab. Darüber hinaus nimmt auch das indigene Wissen über die Verwendung weniger bekannter Pflanzen rapide ab. Die vorliegende Studie bewertet daher die Vielfalt von Pflanzen und Tieren und untersucht die Beziehung zwischen Pflanzenvielfalt und einheimischer Nutzung pflanzlicher Ressourcen entlang des Höhen- und Längsgradienten.
Das Himalaya-Ethnobotanik-Programm basiert auf der Prämisse, dass die Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung der effektivste Weg ist, um artenreiche Gebiete nachhaltig zu erhalten. Durch die Integration ethnobotanischer Daten in Erhaltungspläne arbeiten wir mit Gemeinden zusammen, um ein Programm zu entwickeln, das nicht nur das Ökosystem schützt und wieder auffüllt, sondern auch mit ihrem täglichen Leben und ihren kulturellen Praktiken übereinstimmt.
Kapazitätsaufbau: Wir haben uns lokalen Kolleg*innen zusammengetan, um Doktoranden in den Methoden der Ethnobotanik auszubilden und wertvolle Felderfahrung zu vermitteln. Darüber hinaus unterstützen wir lokale Universitäten bei der Entwicklung ethnobotanischer Forschung und Kurse.
Naturschutz: Unser Ziel ist es, mit der lokalen Bevölkerung Strategien zu entwickeln, wie sie ihre natürlichen Ressourcen nachhaltig nutzen können, damit sie weise Verwalter ihrer Umwelt werden können. Wir arbeiten mit diesen Gemeinschaften zusammen, um Erhaltungspläne zu entwickeln, die sowohl ökologisch vorteilhaft als auch kulturell angemessen sind. Wir glauben auch fest daran, dass die Bewahrung traditionellen Wissens eine Schlüsselkomponente sowohl für die Erhaltung als auch für die Nachhaltigkeit ist.
Lebensqualität: Die Verbesserung der Lebensbedingungen ist ein grundlegender Bestandteil unserer Arbeit in jeder Gemeinde. Unser Programm basiert auf der Überzeugung, dass Umweltaktivitäten eng mit Entwicklungsaktivitäten verknüpft werden müssen, um die Armut in artenreichen, aber wirtschaftlich armen Ländern dauerhaft zu lösen. Wir glauben auch, dass eine gebildete, gesunde Gemeinschaft zu einer besseren Entscheidungsfindung führt.
Märkte und Globalisation
Detaillierte Studien der lokalen Pflanzenmärkte sind von großer Bedeutung, da sogar lokale Behörden beginnen, den breiteren Konsum von lokal geernteten Lebensmitteln und komplementärer Alternativmedizin zu fördern, wie z.B. während der Covid-19 Pandemie. Unsere Arbeit untersucht die Zusammensetzung der gesamten Markt-Flora von Ballungsgebieten in Georgien, Bolivien, Indien, Iran, Pakistan, Peru und Kolumbien und mögliche Veränderungen in den letzten Jahrzehnten, um eine nachhaltige und sichere Nutzung von Pflanzen zu fördern.
Buchprojekt - Ethnobotany of Mountain Regions
Die Buchreihe „Ethnobotany of Mountain Regions“ (Online und Print) wird in Bänden geordnet und umfasst jeweils eine große Bergregion, darunter die nördlichen Anden (Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien), die südlichen Anden (Patagonien), Mittelamerika Nordamerika (Mexiko), Nordamerika (Rocky Mountains), Fern-osteuropa (Nordkaukasus, Ural, Türkei), Zentralasien (Tien Shan, Altai), Himalaya, Afrika, Südostasien, Bergregionen Brasiliens, Osteuropa (Karpaten), Nordafrika und Levante. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt auf der Nutzung menschlicher Pflanzen in den verschiedenen Gebirgssystemen.
Die Inhalte werden nach Global Mountain Makroregionen organisiert. Jede Bergregion wird in Abschnitte unterteilt, die Länder (oder Ländergruppen) abdecken, basierend auf der Pflanzenvielfalt und nicht unbedingt auf politischen oder nationalen Grenzen. Jeder Band, der eine Berg-Makroregion abdeckt, umfasst zwischen 750 und 2000 Seiten.
Jede Bergregion wird in Abschnitte unterteilt, die Länder oder Ländergruppen abdecken. Daher würde der Abschnitt Bergregion Folgendes enthalten: Eine Einführung in die Region, Einführungen in größere Einheiten der Region und 200-500 Pflanzenmonographien.
Medizinpflanzen in Nordperu und Südekuador
Die Grenzregion von Ecuador und Peru ist eines der artenreichsten Gebiete der Erde und damit ein „Hotspot der Biodiversität“ par excellence. Niedrige Pässe in der Andenkette ermöglichen einen einfachen Austausch zwischen der Flora und Fauna des Amazonasbeckens und des pazifischen Tieflandes. Darüber hinaus weist die Region einen sehr schnellen Übergang zwischen den feuchten Bergwäldern der nördlichen Anden und den trockenen Laubwäldern des nördlichen peruanischen Tieflandes auf.
Traditionelle Heilmethoden haben sich in vielen Ländern mit oder ohne Zugang zur konventionellen allopathischen Medizin bewährt. In den Vereinigten Staaten werden diese traditionellen Praktiken zunehmend für Krankheiten nachgefragt, die nicht einfach durch Schulmedizin behandelt werden können. Immer mehr Menschen interessieren sich für das Wissen traditioneller Heiler und für die Vielfalt der Heilpflanzen, die in Gebieten wie Nordperu gedeihen. Während wissenschaftliche Studien zu Heilpflanzen im Gange sind, sind Bedenken hinsichtlich der Erhaltung sowohl der großen Vielfalt von Heilpflanzen als auch des damit verbundenen traditionellen Wissens über Heilmethoden aufgekommen. Um die weitere Erhaltungsarbeit zu fördern, versuchte diese Studie, die Quellen der beliebtesten und seltensten Heilpflanzen zu dokumentieren, die auf den Märkten von Trujillo und Chiclayo verkauft werden, sowie eine Bestandsaufnahme der auf diesen Märkten verkauften Pflanzen zu erstellen, die als Grundlage dienen wird Vergleichsbasis mit künftigen Beständen. Einzelne Märkte und Marktstände wurden anhand der Vielfalt der angebotenen Heilpflanzen einer Clusteranalyse unterzogen.
Für die Erhebung traditioneller Pflanzenverwendungen wurden detaillierte Fragebögen entwickelt, die Fragen zu Pflanzenherkunft, landesüblichem Namen, Krankheitskategorie, Rezeptformulierung, Preisgestaltung und verkauften Mengen enthalten. Die Autoren entschieden sich dafür, die von den Informanten vorgegebenen traditionellen Krankheitskategorien beizubehalten, anstatt zu versuchen, zum westlichen biomedizinischen System zurückzukehren. Umfragen werden auf Spanisch von fließend sprechenden Personen durchgeführt. Gutachter würden sich an Heiler und Marktverkäufer wenden und die Prämisse für die Studie erklären, einschließlich des Ziels der Erhaltung von Heilpflanzen in der Region. Heiler und Marktverkäufer (sowohl männlich als auch weiblich) werden in Peru befragt, nachdem sie den Umfang der Studie erläutert und zuvor ihre Einwilligung eingeholt haben.
Sobald Heilpflanzen identifiziert und gesammelt wurden, werden phytochemische Bioassays durchgeführt, um festzustellen, ob die Pflanzen eine antibakterielle Aktivität aufweisen. Die floristische Zusammensetzung sowie die komplexe Phytochemie traditioneller Kräutermischungen bleiben beklagenswert wenig erforscht. Dies ist umso überraschender, als die traditionellen Bemühungen zur Erforschung von Arzneimitteln auf der Basis einer einzigen Pflanze in den letzten Jahrzehnten zu sehr geringen Ergebnissen geführt haben und tatsächlich eine Erklärung dafür sein könnten, warum so viele Pflanzenarten, die für eine bestimmte Verwendung dokumentiert wurden, sind „ineffizient“ oder „toxisch“, wenn sie in klinische Studien eingeführt werden. Traditionelle Kräutermischungen mit ihrem Reichtum an Verbindungsfragmenten und neuen Verbindungen, die im Herstellungsprozess entstehen, könnten durchaus neue Hinweise für die Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten liefern. Weitere Studien zum Vergleich der zusammengesetzten Zusammensetzung dieser Präparate mit Einzelpflanzenextrakten sowie Untersuchungen zum Vergleich der Wirksamkeit und Toxizität von Kräuterpräparaten mit ihren Einzelpflanzeninhaltsstoffen sind im Gange.
Ethnobotanik der Chácobo - Traditionelles Wissen, Geistiges Eigentum und Nagoya-Protokoll über Zugang und Vorteilsausgleich
Das Chácobo-Ethnobotanik-Projekt ist weltweite die erste Anstrengung, lokale Kollegen in ethnobotanischen Befragungs- und Pflanzensammeltechniken zu schulen, damit sie ihre eigenen Pflanzennutzungstraditionen ohne äußere Beeinflussung dokumentieren können
Bolivien hat eine reiche Vielfalt an indigenen Kulturen mit mindestens dreißig Stämmen unter elf Sprachgruppen. Es gibt jedoch nur wenige detaillierte Studien zur Nutzung von Pflanzen und Ressourcen durch indigene Gruppen, und die Behörden ignorieren immer noch ihr Wissen über die Waldbewirtschaftung. Das Summer Institute of Linguistics (SIL) hatte einen starken Einfluss auf die Veränderung der Kultur vieler Stämme in Bolivien, einschließlich der Chácobo. Die SIL arbeitete von 1953 bis 1980 mit Chácobo-Gemeinden zusammen, was zu einer tiefgreifenden Änderung des Lebensstils und einem permanenten Akkulturationsprozess führte. Brian Boom (Boom 1987) leitete die erste ethnobotanische Studie von Chácobo von 1983-1984 und dokumentierte ihr Wissen nach fast 30 Jahren in diesem kulturellen Wandel. Seitdem ist im Wesentlichen nichts über das ethnobotanische Wissen der Chacobo veröffentlicht worden.
Die Chácobo gehören zur panoischen Sprachgruppe, die etwa zwölf Völker umfasst (Chácobo, Pacahuara, Matis, Matses, Yaminahua und andere). Ende der 1890er Jahre lebten die Chácobo als halbnomadische Jäger und Maniok- und Maiszüchter, wahrscheinlich in zwei Gruppen, eine mit sechs und eine mit vier Familien, im Nordwesten Boliviens, etwa zwischen dem Roguagnado-See und dem Fluss Mamore, südlich von Bolivien ihr jetziges Revier. Während des Kautschukbooms in den frühen 1900er Jahren wurden sie von aggressiveren Stämmen gezwungen, nach Norden zu ziehen, wo Kautschukzapfer, die auch Krankheiten und Epidemien über den Stamm brachten, sie bedrohten. Den Chácobo gelang es jedoch, die meisten äußeren Einflüsse zu vermeiden, während andere Stämme in der Region wie Tiere gejagt wurden, um in Gummistationen zu versklaven. Ihren ersten dauerhaften Kontakt mit der Außenwelt hatten die Chácobo erst 1953 mit Leuten von den Tribes Missions, und 1954 gründete die bolivianische Regierung eine Agentur etwa 15 km vom heutigen Standort Puerto Limones entfernt. Der missionarische Linguist Gilbert Prost kam 1955 unter der Schirmherrschaft des Summer Institute of Linguistics (SIL). Laut Prost lebten zwischen den Flüssen Benicito und Yata vier Chácobo-Gruppen mit etwa 200 Menschen (Boom 1987). Prost und seine Frau lebten noch bis 1980 bei den Chácobo. Neben der Übersetzung des Neuen Testaments ins Chácobo machten sie einige Beobachtungen zu kulturellen und sprachlichen Praktiken. 1964 gelang es Prost, ein Gebiet im Norden des angestammten Landes der Chácobo zu kaufen und die Gemeinde Alto Ivon zu bilden, und der Großteil der verbleibenden Bevölkerung zog dorthin. 1965 wies die bolivianische Regierung den Chácobo schließlich 43.000 Hektar Land zu, obwohl diese Fläche weniger als 10 % ihres ursprünglichen Territoriums ausmachte. Der Einfluss von Prost verursachte einen tiefgreifenden kulturellen Wandel unter den Chácobo, einschließlich der Aufgabe traditioneller Kostüme und Tänze im Jahr 1969. Derzeit zählt die Bevölkerung der Chácobo-Gemeinde etwa 500 Menschen, mit Alto Ivon als größter Siedlung und Tokio, Motacuzal, Siete Almendros, und andere kleinere Gemeinden entlang des Yata-Flusses. Das heutige Territorium des Stammes umfasst 450.000 Hektar und entspricht in etwa der ursprünglichen Ausdehnung des angestammten Landes des Stammes. Die Gemeinde Alto Ivon, das Zentrum des Chácobo-Territoriums, liegt etwa 112 km südlich von Riberalta am Fluss Ivon, einem Nebenfluss des Beni. Die Höhe beträgt etwa 200 m und kann als Amazonas-Regenwald klassifiziert werden. Gummibäume (Hevea brasiliensis) und Paranuss (Bertholletia excelsa) sind reichlich vorhanden. Die durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 26,8 °C, mit einer durchschnittlichen jährlichen Niederschlagsmenge von 1,56 mm, basierend auf Beobachtungen in Riberalta. Eine ausgeprägte Trockenzeit dauert von Juni bis November. Früher wurden die Chácobo von einem Cacique geführt. Heute gibt es zwei indigene Organisationen: Die eng mit den Evangelisten verbundene Capitanía Mayor Chácobo und die von der Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) anerkannte Chácobo-Pacahuara Association, unterstützt von der Central de Pueblos Indigenas del Beni ( CPIB) und der Confederacion de Pueblos Indigenas de Bolivia (CIDOB).
Das Projekt untersucht das aktuelle traditionelle ökologische Wissen (TEK) zur Pflanzennutzung des Chacobo und Pacahuara in Beni, Bolivien und hat drei Ziele: 1) aktuelles traditionelles Pflanzenwissen durch Interviews und Erhebungen zu entdecken und zu dokumentieren, 2) die aktuelle Flora zu inventarisieren der Region, und 3) um das erworbene Wissen sowie frühere Daten an die Gemeinschaft zu repatriieren.
Ethnobotany Research and Applications
Ethnobotany Research and Applications ist eine elektronische, von Experten begutachtete, multidisziplinäre und mehrsprachige Zeitschrift, die sich der schnellen Verbreitung aktueller Forschungsergebnisse in allen Bereichen der Ethnobiologie widmet. Die Zeitschrift wird derzeit vom Refereat Botanikdes SMNK, mit dem Department of Ethnobotany, Institute of Botany, Ilia State University, Tbilisi, Georgia in Zusammenarbeit mit Saving Knowledge / Ethnomont herausgegeben. Die Zeitschrift sucht Manuskripte, die neuartig, integrativ und so geschrieben sind, dass sie einem breiten Publikum zugänglich sind. Dies umfasst eine Reihe von Disziplinen (Bio- und Sozialwissenschaften), die sich insbesondere mit theoretischen Fragestellungen im Bereich der Ethnobiologie befassen, die zu praktischen Anwendungen führen. Artikel können auch auf den Perspektiven von Kulturschaffenden und anderen mit Einblicken in Pflanzen, Menschen und angewandte Forschung basieren. Außerdem werden Datenbankartikel, ethnobiologische Inventare, ethnobotanische Anmerkungen, methodologische Übersichten, Bildungsstudien und theoretische Diskussionen veröffentlicht.
Arbeiten, die hauptsächlich agronomisch oder gartenbaulich sind, und solche, die sich hauptsächlich mit analytischen Daten zu den chemischen Bestandteilen von Pflanzen oder Bioassays befassen, fallen nicht in den Geltungsbereich der ERA und sollten an anderer Stelle eingereicht werden.
ERA ist in Scopus und Crossref indiziert.
Stadtvegetation
Städte sind anders als das Land um sie herum – was jedem augenscheinlich einleuchtet, hat bei genauerer Betrachtung eine Vielzahl an Facetten. An Facetten aus so unterschiedlichen Bereichen wie Städtebau und Infrastruktur, Ressourcennutzung und -gewinnung, Klima und Wetter, und vielen mehr. Für die botanische Forschung stellen Städte interessante Sonderflächen dar, da sie sehr spezifische Standortstypen und Nischen bieten. Dies reicht von naturnah angelegten Parkanlagen über geschotterte Wegränder und begrünte Dächer bis hin zur Pflasterfuge (vgl. Priemetzhofer & Berger 2001). Allein schon aufgrund der intensiven Verkehrsanbindung finden sich die ersten Vorkommen von neu angekommenen Neophyten nicht selten in Städten. So ergibt sich ein »Cocktail« aus einheimischen Arten und solchen, die bewusst angepflanzt oder unbeabsichtigt eingeschleppt wurden und werden. Der Vergleich von Städten untereinander sowie von Städten mit ihrem jeweiligen Umland bietet daher Ansatzpunkte für die Standortökologie, Chorologie, Populationsbiologie und weitere Felder.
Priemetzhofer, F. & Berger, F. (2001): Flechten in Pflasterritzen – ein bemerkenswerter, mit Füßen getretener Sonderstandort. – Beitr. Naturk. Oberösterreichs 10: 355-369