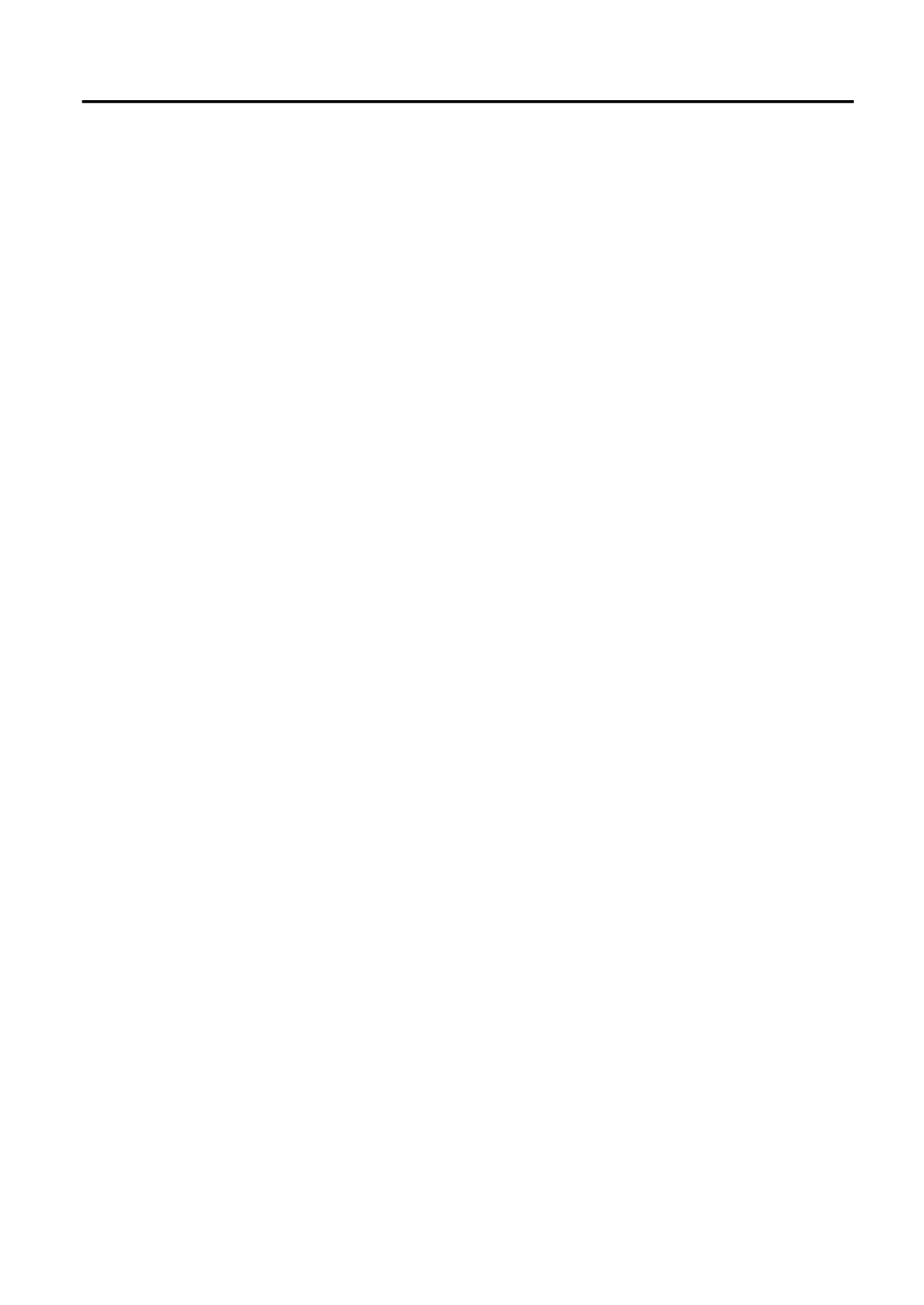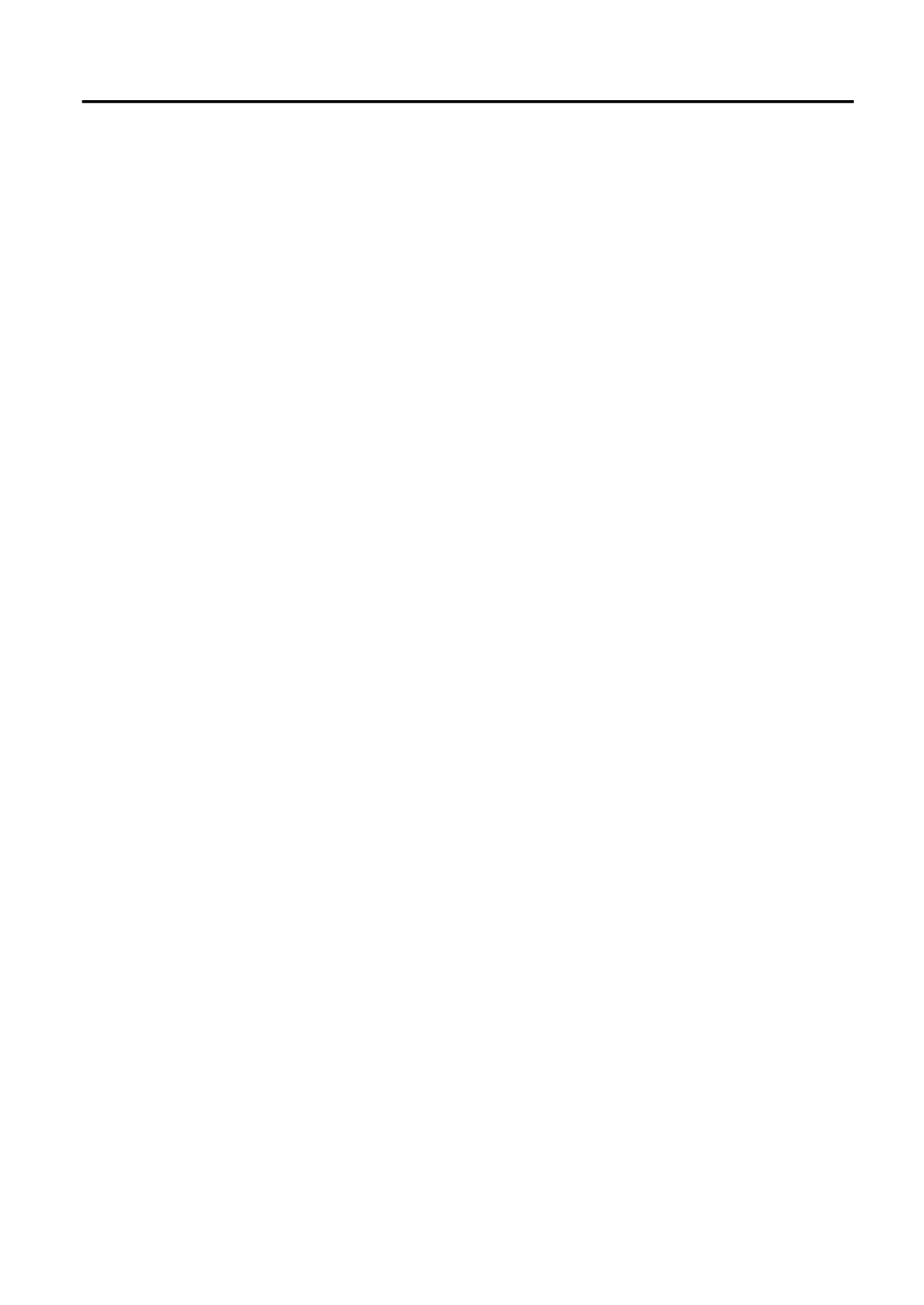
R
aub
et al.: Zoologische Datenbanken am SMNK
93
3. Behörden, (Planungs-)Büros und sonstige Nut-
zer mit wissenschaftlichem Hintergrund sind an
ganz bestimmten Informationen zu einzelnen
Arten oder zur Fauna bestimmter Regionen
oder Standorte und meist auch an aufbereiteten
Daten (Artenlisten, Häufigkeiten) interessiert.
Hier stellt sich insbesondere die Frage nach den
Rechten und der Nutzung solcher Daten, eine
Frage die im Moment auf nationaler sowie inter-
nationaler (EU) Ebene ausgiebig diskutiert wird
und in Zukunft eine große Rolle spielen wird.
4. Die Forschergemeinde („scientific community“)
möchte in möglichst umfangreichen (evtl. in-
stitutionenübergreifend zusammengestellten)
Datenpaketen über die zugehörigen Meta-
daten explizit definierte Recherchen durchfüh-
ren, um z.B. im Vorfeld von Forschungsvorha-
ben die vorhandenen Kenntnisse zu erheben
oder um für einen Vergleich mit eigenen Daten
oder im Rahmen von (Meta-)Analysen neue
Erkenntnisse zu gewinnen.
Ein zentrales Thema der Forschung an Naturkun-
demuseen ist die wissenschaftliche Erfassung
und Beobachtung der Biodiversität – der Vielfalt
an Ökosystemen, Arten und Genen. Dazu wer-
den in der biowissenschaftlichen Abteilung des
SMNK floristische und faunistische Aufsamm-
lungen, taxonomisch-systematische Arbeiten
unter Einbeziehung morphologischer und gene-
tischer Merkmale und die quantitative Erfassung
von Funktionen und Leistungen einzelner Arten
und Gemeinschaften in einzelnen Ökosystemen
durchgeführt (B
ihn
et al. 2008, V
erhaagh
et al.
2009, H
öfer
& V
erhaagh
2010, H
öfer
et al. 2011,
T
änzler
et al. 2012). Dabei entstehen heute große
Datenmengen für statistische Auswertungen am
Computer, z.B. durch das Sammeln vieler Tau-
sender Individuen (wirbelloser Tiere) in möglichst
vielen Untersuchungsflächen mit automatischen
Fallen oder durch die kontinuierliche Messung
von abiotischen (Umwelt-)Variablen (Klima, Bo-
den), die zur Korrelation mit biotischen Faktoren
eingesetzt werden. Angesichts der globalen
Probleme, die mit Biodiversitätsverlust, Klima-
wandel, Verlust von Bodenfruchtbarkeit und dem
Auftreten invasiver Arten einhergehen, müssen
solche Daten, über die primäre Auswertung (und
Publikation) hinaus, nachhaltig gesichert und
verfügbar gehalten werden.
Ein anschauliches Beispiel dafür liefert das Pro-
jekt „Erfassung und Analyse des Bodenzustands
im Hinblick auf die Umsetzung und Weiterent-
wicklung der Nationalen Biodiversitätsstrategie“,
an dem die Zoologen des SMNK von 2008-2011
zusammen mit Bodenzoologen des Sencken-
berg Museums Görlitz, der RWTH Aachen und
der ECT GmbH in Flörsheim gearbeitet haben.
Es gründet auf dem Wunsch des Umweltbun-
desamts (UBA), biotische Daten zu Bodendauer
beobachtungsflächen (BDF) der Bundesrepublik
Deutschland für einen verbesserten Schutz der in
§ 2 des BBodSchG (1998) beschriebenen Funk-
tion des Bodens als Lebensraum für Bodenor-
ganismen zu nützen. Erste Recherchen zeigten
allerdings, dass zoologische Daten nur für we-
nige (99 von 795) BDF und nur für Regenwür-
mer vorliegen und damit die Bodenbiodiversität
auf deutschen BDF (und überhaupt in Deutsch-
land) praktisch nicht bekannt ist. Aufgaben des
Projekts waren (1) die Zusammenstellung und
kritische Beurteilung der für die Nutzung der Bo-
denbiodiversität im Rahmen der Bodenqualitäts-
beurteilung bisher vorgeschlagenen Methoden
und Konzepte (einschließlich der gesetzlichen
Rahmenbedingungen), (2) der Aufbau einer
Datenbank zur Erfassung bodenbiologischer
Daten zu edaphischen Organismen sowie (3)
deren Auswertung in Hinsicht auf ihre Reprä-
sentativität, die Zusammenstellung der in den
Bundesländern und der Literatur vorhandenen
bodenbiologischen Daten zu Mikroorganismen,
Springschwänzen, Hornmilben, Regenwürmern
und Enchyträen und (4) basierend auf den Er-
gebnissen die Erstellung von Empfehlungen zur
Weiterentwicklung von bodenbiologischen Moni-
toringverfahren (R
ömbke
et al. 2012a,b).
Die Auswertung der mit großem Aufwand zusam-
mengetragenen und qualitätsgeprüften Daten hat
in erster Linie die enorme Datenlücke aufgezeigt,
die die Erfüllung des Ziels des UBA vorerst nicht
möglich macht. Umso wichtiger ist es, diese Da-
tengrundlage in Form eines expertengestützten,
bedienerfreundlichen bodenzoologischen In-
formationssystems („Edaphobase“, s.u.) für die
Wissenschaft und Anwendung dauerhaft verfüg-
bar zu machen und damit weitere standardisierte
Erhebungen zu ermöglichen bzw. zu provozieren
und Datenlücken zu schließen.
Ein weiteres Beispiel ist die bodenzoologische
Untersuchung der Einödsberg-Alpe (H
öfer
et
al. 2010): Bei der sechsjährigen Untersuchung
des ca. 100 ha großen Gebiets im Allgäu wur-
den mehr als 570 Wirbellosen-Arten nachgewie-
sen und über 30.000 Datensätze in einer lokalen
MS-Access
®
Datenbank erfasst. Daraus sind be-
reits viele Aspekte publiziert (M
uster
et al. 2008,
H
arry
& H
öfer
2010; H
öfer
et al. 2010a,b, H
o
-
rak
& W
oas
2010, U
rban
& H
anak
2010, H
arry
et