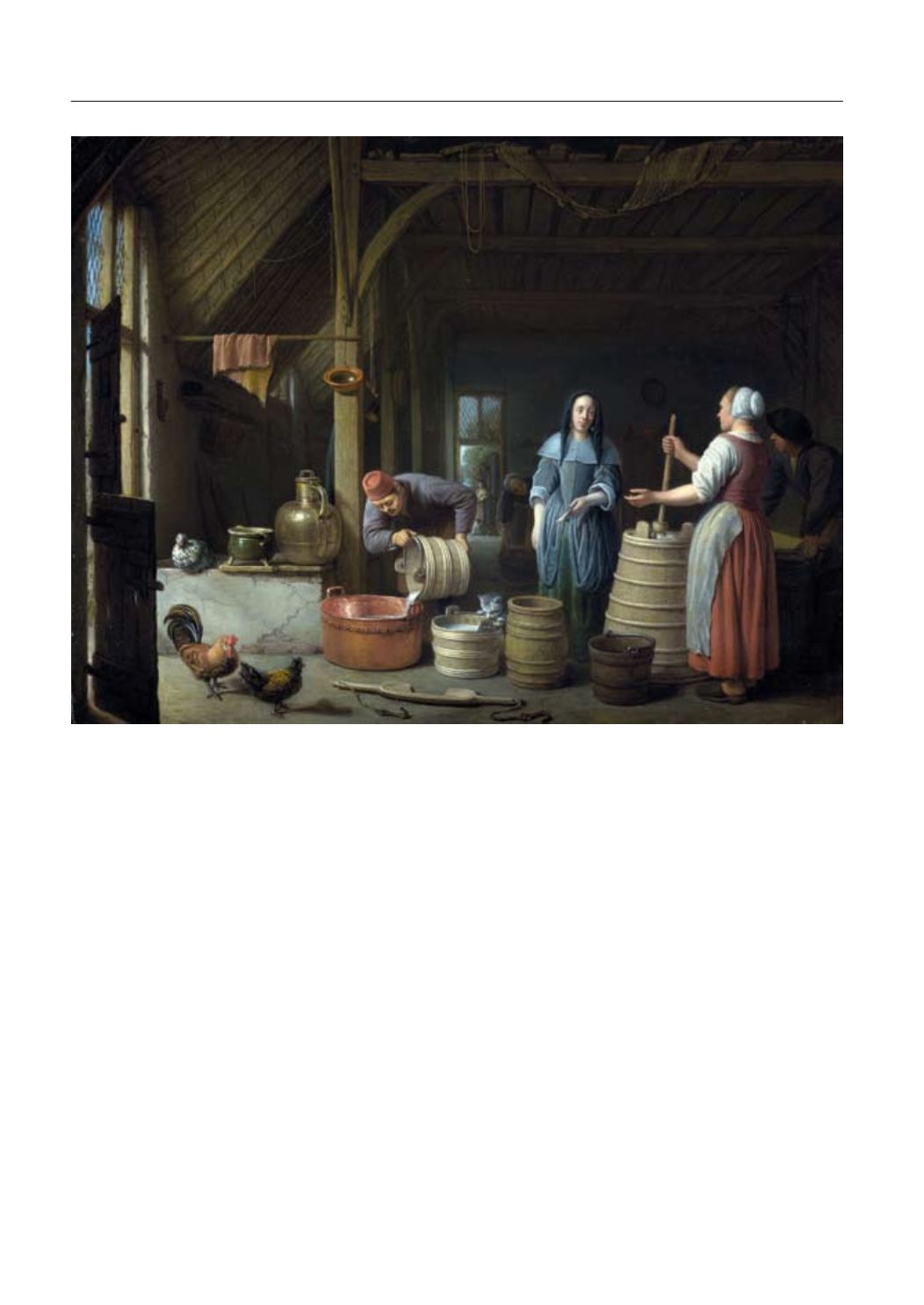
122
Carolinea 71
(2013)
erinnert hier etwas an Hühner mit Rosenkamm,
aber auch an die ersten Kammabbildungen der
späteren Augsburger Hühner im deutschen Ras-
sestandard bei
B
ungartz
, deren Kronenkamm im
hinteren Bereich noch mehr oder weniger offen
und von der erwünschten Becherform noch weit
entfernt war. Dafür gibt das Bild ein Detail für die
heutigen Kronenkammhühner preis: „Rotes Ge-
sicht, rote Kehllappen aber weiße Ohrscheiben“.
Beigestellt sind noch eine weiße und goldfarbige
„Paduanerhenne“.
Wohl wegen seiner auffälligen Kammform fand
auch ein prächtiger schwarzer Hahn mit Kro-
nenkamm seinen Platz auf
J
an
W
eenix
(1642 –
1719) Jagd- und Früchtestillleben aus dem Jahr
1714 (Abb. 19). Dies ist neben dem Altarbild
von
F
errer
II
nach fast 300 Jahren ein weiterer
Beleg für Kronenkammhühner mit schwarzem
Gefieder.
Haben die Gemälde von
C
uyp
und
d
’H
ondecoeter
noch mehr oder weniger Porträtcharakter, findet
sich auf dem Bild „Häusliche Milchverarbeitung“
(1664, Abb. 20a) von
H
endrik
M
artensz
. S
orgh
(1611 -– 1670) aus Rotterdam, einer Neuerwer-
bung der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, eine
besonders schöne und informative Darstellung
über die Hühnerhaltung dieser Zeit. Gerade weil
S
orgh
nicht gerade zu den typischen Vogelma-
lern zu zählen ist, hat er mit seinem Bild eher
beiläufig einen wichtigen Markstein der Ras-
setierhaltung bei Haushühnern dokumentiert:
In der Detailansicht (Abb. 20b, links) erkennt
man einen Kronenkammhahn mit einer Spren-
kelhuhnzeichnung, ähnlich den heutigen Bra-
kel- oder Hamburger Hühnern, sowie die weiß
hervorstechenden Ohrscheiben am Kopf. Er ist
in Begleitung zweier Hauben tragender, padu-
anerähnlichen Hennen. Interessant ist bei die-
Abbildung 20a.
H
endrik
M
artensz
. S
orghs
Gemälde „Häusliche Milchverarbeitung“ aus dem Jahre 1664 (Staatliche
Kunsthalle Karlsruhe).








