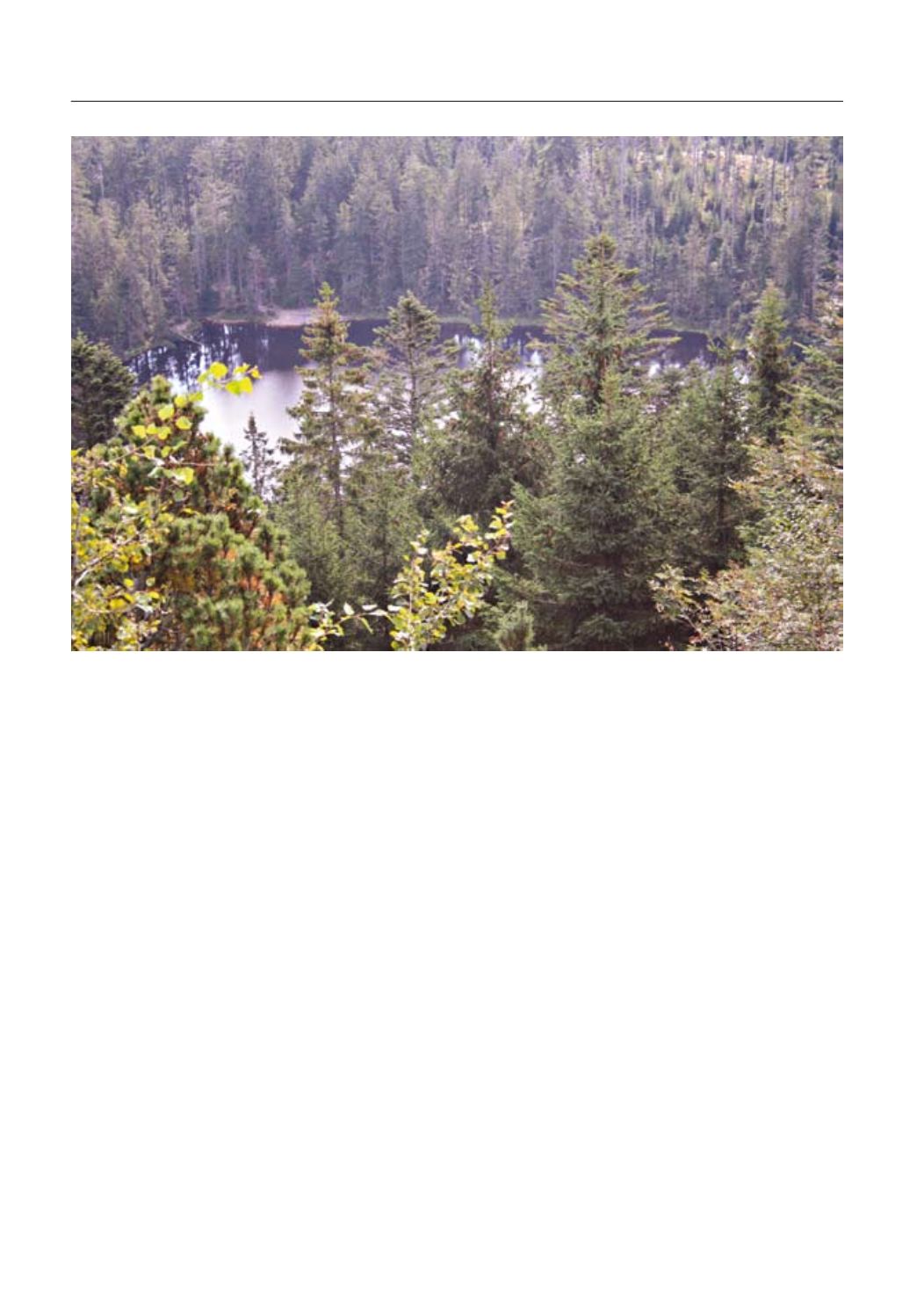
154
Carolinea 71
(2013)
waldreservat in Baden-Württemberg. 1998 wur-
de das Gebiet auf 150 ha vergrößert. Die Jahres-
durchschnittstemperatur beträgt nur 5-6 °C, der
Jahresniederschlag rund 2000 mm.
Das Gebiet lässt sich grob in Bergkiefern (
Pi-
nus rotundata
)-Bestände mit vordringender
Fichte, die Waldgesellschaften der Karwand
(Fichte herrscht vor, jedoch mit deutlichem Tan-
nenanteil, Buche im zentralen ältesten Teil des
Waldes), die fichtenreichen Waldgesellschaften
östlich der Karwand (Fichte dominiert, jedoch
heute durch Borkenkäfer stark dezimiert, Kiefer
vereinzelt auf nährstoffärmeren Bergrücken) und
das Vegetationsmosaik der Vermoorungen un-
terteilen (zu Details siehe
W
olf
1992; vgl. auch
Vegetationskarte in Abb. 2). Die heutige Vege-
tation hat sich von der ursprünglich natürlichen
Vegetation entfernt, da sich durch menschliches
Einwirken die Fichte wohl irreversibel etabliert
hat. Dies geschah vor allen Dingen zu Lasten
der Buche. Die Besiedlung des Gebiets erfolgte
gegen Ende des 11. Jahrhunderts. Im 14. Jahr-
hundert einsetzende Nutzungsformen (Harzen,
Waldweide, Streunutzung) hatten erste Auswir-
kungen auf den Bestand. Einschneidend ver-
ändert/zerstört wurde das Waldbild schließlich
im 18. und 19. Jahrhundert durch Holznutzung
und den großen Brand von 1800. Es folgten
Ansaaten und Aufforstungen mit Kiefer, Fich-
te und Tanne. Die Besonderheit dieses Bann-
walds liegt u.a. darin, dass der zentrale Bereich
der Karwand nicht oder nur sehr unwesentlich
durch den Brand von 1800 beeinträchtigt wurde.
Dort kommen auch, auf allerdings sehr kleiner
Fläche, die Buche und die ältesten Tannen im
Bereich des Bannwalds vor.
Im Bereich des Bannwalds wurden bereits de-
taillierte Untersuchungen zur Vegetation (zuletzt
W
olf
1992,
W
ohlfahrt
& B
ücking
2001, W
ohl
-
fahrt
& R
iedel
2001) und Fauna (vgl. die Kom-
pilation in
B
ücking
et al. 1998) durchgeführt. Die
einzige Person, die im Gebiet regelmäßig die
Pilze studierte, war der Bühler
H
errmann
N
eu
-
bert
. Er sammelte im Gebiet von 1968 bis 1993.
Bei den ersten Kollektionen handelt es sich um
lignicole Nichtblätterpilze, von denen sich 25
Abbildung 1. Blick auf den Wildsee von Westen. – Foto:
M. S
choller
.








