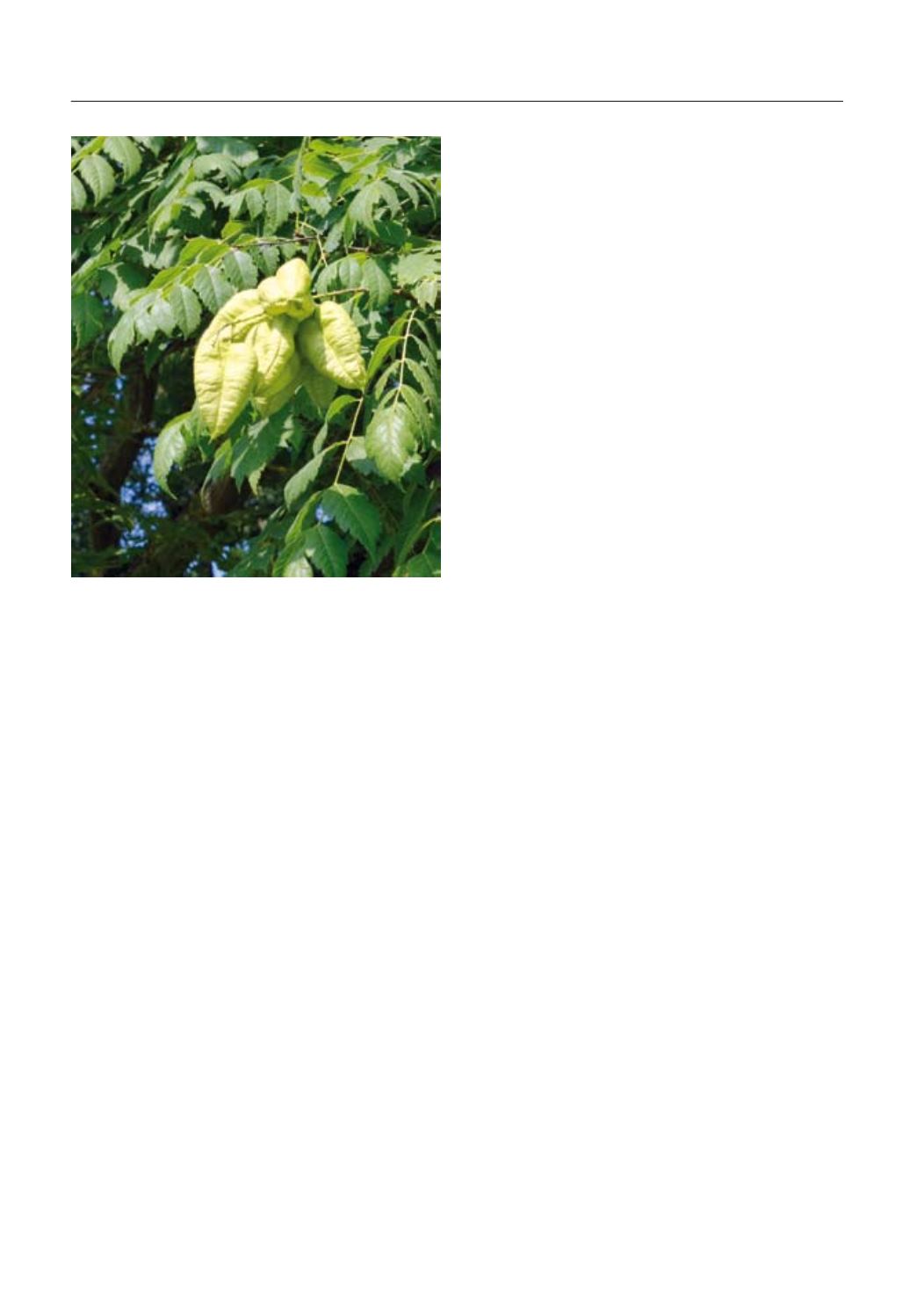
20
Carolinea 71
(2013)
passive oder aktive Bewegungen der Staubge-
fäße verantwortlich sein können, dass Pollenkör-
ner sehr unterschiedliche und spezifische Gestalt
haben und dass ein einzelnes Pollenkorn auf der
Narbe ausreicht, um eine Befruchtung zu errei-
chen. Da er sehr verschiedene Blütenformen un-
tersuchte, entdeckte er zugleich, dass es bei der
Bestäubung unterschiedliche Anpassungen der
Blüten an unterschiedliche Insekten gibt, ordnet
sogar Blütenformen bestimmten Insekten zu. Er
erkennt u.a., dass die Mistel auf Insektenbestäu-
bung angewiesen ist, entdeckt bei Malven die
Proterandrie, bei der der Pollen zeitlich so vor
der Narbe reift, dass eine Selbstbestäubung ver-
hindert wird. Den Nektar spricht er als Lockmittel
an und setzt ihn mit dem Honig gleich. Auch die
Doppelwandigkeit des Pollenkorns mit Exine und
Intine erkannte er als Erster.
K
oelreuter
wurde durch seine Forschungen
letztlich auch zum Vater der Blütenökologie.
Selbst wenn ihm im Detail mancher Irrtum un-
terlief, so hat er doch den mitunter komplizierten
Bestäubungsmechanismus in zahlreichen Fäl-
len richtig aufklären können. Dass Irrwege und
spätere Kritik bei Fachkollegen nicht ausbleiben
konnten, betrifft u.a. seine Versuche die Sexua-
lität der Kryptogamen zu ergründen, doch kön-
nen einzelne Irrtümer nicht die Bedeutung seiner
grundsätzlichen Erkenntnisse mindern. Zu ihnen
gehört, dass auch bei den Pflanzen ohne Sexu-
alität keine Vererbung neuer Merkmale, sondern
nur die Weitergabe vorhandenen oder ggf. durch
Mutation veränderten Erbmaterials an Nach-
kommen möglich ist. Dies kann durch Teilung,
Sprossung, Strobilation oder vergleichbare Me-
chanismen erzeugt – aber eben nicht „gezeugt“
– werden. Heute wissen wir, dass nur die stän-
dige Vermischung von Erbgut über Generationen
hinweg ein zentraler Motor der Evolution ist.
K
oelreuter
war, ein Lebensalter vor
D
arwin
, kein
Evolutionist. Er war aber ein scharfer Beobach-
ter und Analytiker der Gesehenen, dachte in ei-
ner anderen, nicht weniger modernen Richtung:
Als einer der allerersten Ökologen erkannte und
schrieb er, dass die Vielfalt des Lebens auf einem
Netzwerk beruht, in dem die unterschiedlichsten
Lebewesen durch vielfältige Abhängigkeitsver-
hältnisse miteinander verknüpft sind. Seine Be-
obachtungen an den die Blüten bestäubenden
Käfern, Fliegen, Bienen und Wespen führten ihn
zu dem Schluss:
„C’est ainsi que la nature parvint à son but de fé-
condation et de propagation de notre arbrisseau
par le moyen de ces petites créatures, que plu-
sieures faux philosophes ont regardé avec tant
ignorance comme des êtres inutiles. Ces ani-
maux, en goûtant avec délectation le mets le plus
doux, trouvent non seulement leur propre avan-
tage, mais ils préparent en même temps, sans le
savoir, un aliment futur, tant pour la posterité de
leur proprre espèce, que pour tant d’autres créa-
tures, avant leur existence. Voilá un nouvel ex-
emple et qui jusqu’ à ce jour n’a point été remar-
qué, qui nous prouve clairement l’intimité entre le
règne animal et le règne végétal et la necessité
de leur connexion dans lèconomie de la nature”
[zitiert nach
B
ehrens
, 1894: 315].
J
oseph
G
ottlieb
K
oelreuter
steht mit der Beru-
fung zum “Aufseher und Direktor der Fürstlichen
Gärten“ und zum „Professor der Naturgeschichte”
im Jahr
1763
neben des Stadtgründers Liebe zu
Tulpen und den naturkundlichen Bestrebungen
der Markgräfin
C
aroline
L
uise
,
am Beginn natur-
wissenschaftlicher Interessen und Forschungen
in Karlsruhe. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts
wurden seine Beobachtungen und Forschungs-
ergebnisse allgemein anerkannt und gewürdigt.
Die Königlich Preußische Akademie in Berlin und
die Holländische Akademie der Wissenschaften
in Harlem stellten in seinem Sinne Preisaufga-
Abbildung. 4. Die „Blasen“ des Blasenbaums
Koelreu-
teria paniculata
. – Foto: S.
R
ietschel
.








