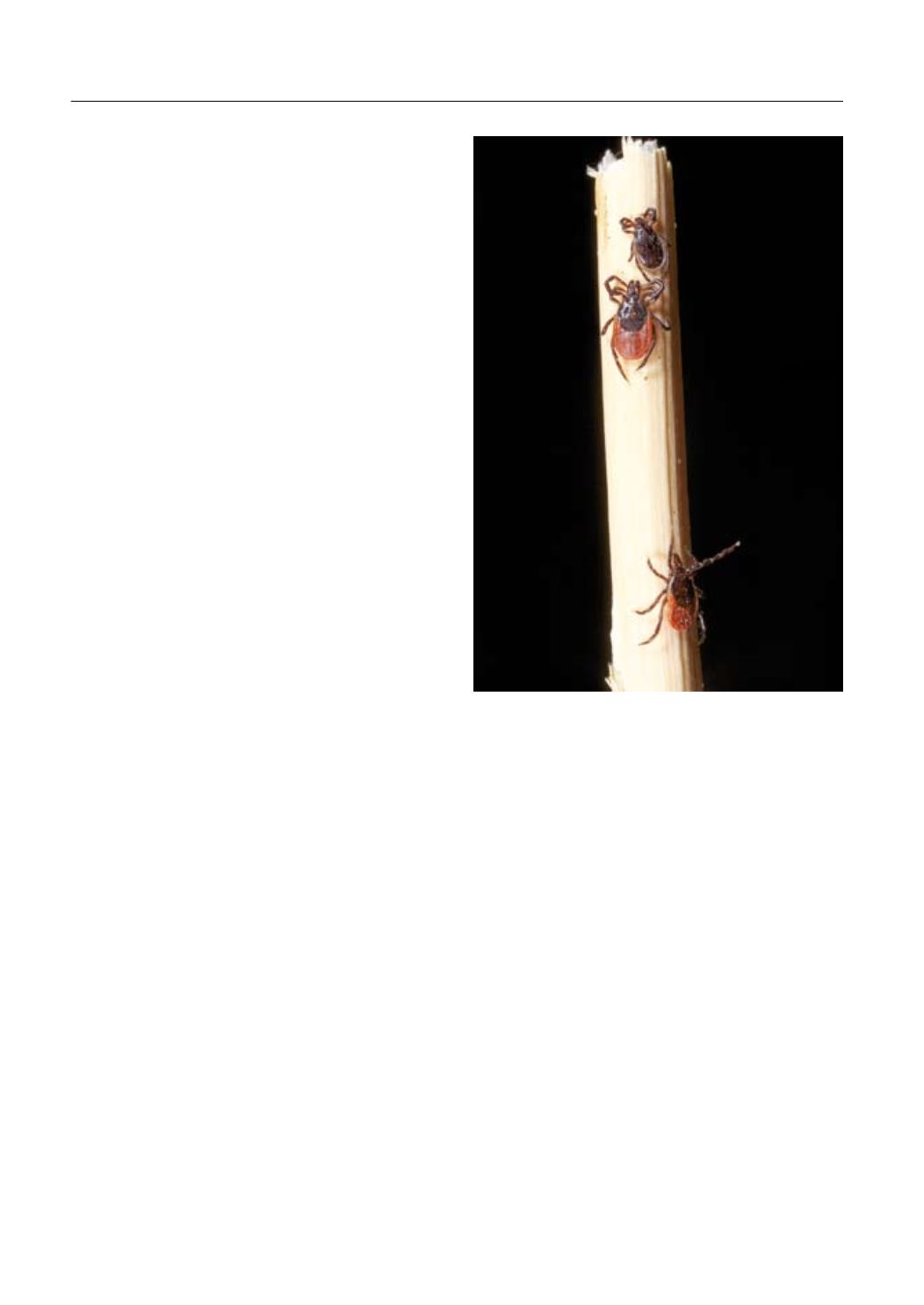
60
Carolinea 71
(2013)
tur und Luftfeuchtigkeit, die sich auf die Entwick-
lungsgeschwindigkeit auswirken, dauert es eini-
ge Wochen, bis die Larven schlüpfen (
B
ala
shov
1972,
O
liver
1989). Die Larve muss nun einen
Wirt finden – normalerweise ein kleines Säuge-
tier oder ein Vogel –, um Blut und andere Körper-
säfte zu saugen, bis sie schließlich vollgesogen
ist. Der Saugakt erstreckt sich über ca. 5-7 Tage,
nach denen sich die vollgesogene Larve auf den
Boden fallen lässt. Dort häutet sie sich innerhalb
einiger Wochen zur Nymphe. Diese folgt dem-
selben Schema wie die Larve, findet einen neu-
en Wirt, saugt sich voll, lässt sich abfallen und
häutet sich zum adulten Männchen bzw. Weib-
chen (
B
alashov
1972,
O
liver
1989). Für das wei-
tere Geschehen gibt es zwei Möglichkeiten. Die
Männchen und Weibchen der Gattung
Ixodes
paaren sich in der Regel vor der Wirtsfindung;
während Männchen nicht auf eine Blutmahlzeit
angewiesen (
O
liver
1989) sind, ist diese dage-
gen bei Weibchen erforderlich, um die Eiproduk-
tion und -ablage gewährleisten zu können. Bei
anderen Gattungen, inklusive
Dermacentor
und
Rhipicephalus
, benötigen sowohl Männchen als
auch Weibchen eine Blutmahlzeit (
O
liver
1989).
Der gesamte Entwicklungszyklus kann innerhalb
eines Jahres (z.B.
Dermacentor reticulatus
) ab-
geschlossen werden oder benötigt mehrere Jah-
re (z.B.
Ixodes ricinus
).
Unterschiedliche Zeckenarten zeigen unter-
schiedliche Wirtspräferenzen:
Ixodes ricinus
(Abb. 2) befällt Reptilien, Vögel und Säuger,
wobei die Größe der Blutmahlzeit und somit der
reproduktive Erfolg sowohl von der Wirtsart als
auch vom Immunstatus des Wirtsindividuums
abhängen (
O
liver
1989).
Ixodes hexagonus
ist
dagegen in der Wahl der Wirte in allen Stadien
spezialisiert und befällt hauptsächlich Igel und
seltener Säuger der Familie Mustelidae (Marder-
artige). Eine noch engere Wirtspräferenz zeigt
Ixodes lividus.
Diese Art wurde bisher fast aus-
schließlich auf der Uferschwalbe
Riparia riparia
gefunden (
A
rthur
1963,
N
osek
&
S
ixl
1972,
P
et
-
ney
et al. 2012).
Zecken befinden sich nur zu einem kleinen Teil
ihres Lebens auf dem jeweiligen Wirtstier. Die
meiste Zeit, bis zu 99 %, verbringen sie damit,
sich zum nächsten Stadium weiterzuentwickeln
und auf Wirte zu warten (
O
liver
1989). Dies be-
deutet, dass Entwicklung und Aktivität während
dieser Zeit von lokalen Umweltbedingungen,
also z.B. Temperatur und Luftfeuchtigkeit, abhän-
gig sind (
E
strada
-P
eña
2008). Bei Zeckenarten
wie
Ixodes ricinus
,
Dermacentor marginatus
und
Dermacentor reticulatus
(Abb. 3)
bilden sowohl
das Habitat in Wäldern und Graslandschaften
als auch das
Mikrohabitat
, also biotische und
abiotische Faktoren der direkten Umwelt, diese
Umgebung. Bei
Ixodes hexagonus
und
Rhipice-
phalus sanguineus
, die stark an Wirtsnester bzw.
in Mitteleuropa an menschliche Behausungen
gebunden sind, steht mehr das
Mikroklima
im
Vordergrund.
2.2 Epidemiologie von zeckenübertragenen
Pathogenen
Unser Verständnis der Epidemiologie infektiöser
Krankheiten ist in den letzten 25 Jahren in be-
deutender Weise vorangekommen, was haupt-
sächlich den theoretischen Abhandlungen von
A
nderson
und
M
ay
zu verdanken ist (zusammen-
gefasst in
A
nderson
&
M
ay
1991). Typisch für ze-
ckenübertragene Pathogene ist eine komplexe
epidemiologische Dynamik, die von verschie-
Abbildung 2. Männchen (oben) und Weibchen des Ge-
meinen Holzbocks
Ixodes ricinus
. – Foto:
D. P
amlin
.








