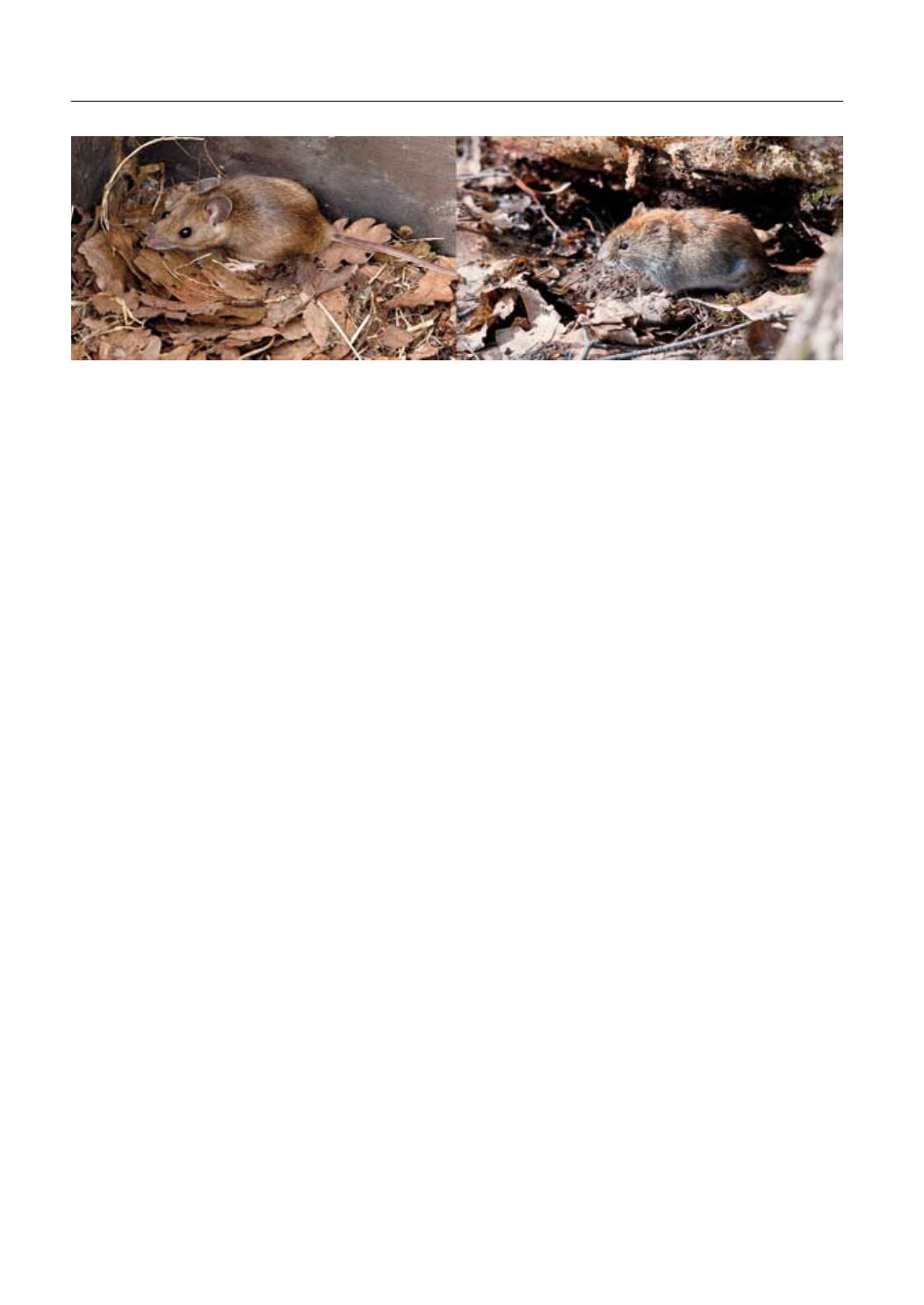
72
Carolinea 71
(2013)
Wirtsfindungsaktivität auslösen (
B
elan
&
B
ull
1995); insbesondere aber handelt es sich um
chemische Substanzen, die der Wirt abgibt. So
ist CO
2
, das in der Atemluft von Wirbeltieren hö-
her konzentriert vorkommt als in der Atmosphäre,
schon lange als eine Substanz zur Wirtsfindung
bekannt (
G
arcia
1962,
K
och
&
M
c
N
ew
1981)
und wurde genutzt, um die Populationsdichten
von
Ixodes ricinus
zu bestimmen (
G
ray
1985).
Auch durch andere Komponenten der Atemluft,
wie H
2
S, NO, Aceton, Lacton und NH
3,
kommt es
zu einer Reaktion der Zecke (
S
teullet
&
G
uerin
1992a, b, 1994,
M
c
M
ahon
&
G
uerin
2002). In den
meisten Fällen wurden solche Untersuchungen
im Labor durchgeführt; die Effektivität dieser
Substanzen unter natürlichen Bedingungen, mit
Ausnahme von CO
2
, ist nicht bekannt.
Sobald sich die Zecke in einer geeigneten Um-
gebung befindet, ist es wahrscheinlich, dass
einer dieser Stimuli bewirkt, dass die Zecke die
Präsenz eines potenziellen Wirtes mittels ihrer
Pulvilli – Sinnesorgane, die sich an der Spitze
der beiden Vorderbeine befinden – über kurze
Distanz wahrnimmt. Dies ist der Auslöser für die
Zecke, um den Wirt zu besiedeln.
3.4.3 Wirts-Immunität
Die Fähigkeit der Wirte, eine Immunität gegen
Zecken und/oder die von ihnen übertragenen
Krankheiten zu entwickeln, ist artspezifisch un-
terschiedlich (
W
ikel
1996). In Europa erlangen
Gelbhalsmäuse (
Apodemus
flavicollis
) keine
Immunität gegen
Ixodes ricinus
,
wogegen dies
bei Rötelmäusen (
Myodes glareolus
) der Fall ist.
Diese Immunität führt bei den Zecken zu einer
geringeren Gewichtszunahme beim Blutsau-
gen und einer geringeren Überlebensrate (
D
izij
&
K
urtenbach
1995). Zusätzlich weisen diese
beiden Nagerarten Unterschiede in ihrer Anste-
ckungsfähikeit auf:
Apodemus flavicollis
beher-
bergt
meist mehr infizierte Zecken als
Myodes
glareolus
(
H
umair
et al. 1999).
3.4.4 Immunosuppression
Substanzen im Zeckenspeichel – untersucht wird
der Speicheldrüsenextrakt (Salivary Gland Ex-
tract, SGE) – können eine immunosuppressive
(Immunsystem unterdrückende) bzw. immuno-
modulierende (Immunsystem beeinflussende)
Wirkung auf den Wirt ausüben. Dabei beeinflus-
sen diese Stoffe sowohl die angeborene als auch
die adaptive, also erworbene Immunität (
H
annier
et al. 2003). SGE von
Ixodes ricinus
kann bei-
spielsweise die Vermehrung von Lymphozyten,
z.B. von T-Zellen, hemmen (
B
arriga
1999,
M
ejri
et al. 2001,
K
ovar
et al. 2001, 2002).
In vitro wird die Aktivität von T-Killerzellen durch
den Speichel von
Dermacentor reticulatus
ge-
hemmt (
K
ubes
et al. 1992). Auch SGE von
Rhi-
picephalus sanguineus
inhibiert die Vermehrung
von T-Lymphozyten und beeinflusst die antibio-
tische Aktivität von Makrophagen (
F
erreira
&
S
il
-
va
1998). Eine Modulierung des Immunsystems
schließt auch die Hemmung von Cytokinen ein.
Cytokine sind Botenstoffe, die zwischen den ein-
zelnen Komponenten des Immunsystems vermit-
teln. Durch die verminderte Produktion von Inter-
leukin 10 (IL 10) und des Tumor-Nekrose-Faktors
α
(TNF-
α
) werden B-Zellen gehemmt (
H
annier
et
al. 2004). Die Inhibierung von Cytokinen kann
die Übertragung von Pathogenen erleichtern
(K
opecky
et al. 1999). Durch die Beeinflussung
dieses Systems kann
Ixodes-ricinus-
SGE das
Verhältnis von TH1- zu TH2-Zellen (T-Helferzel-
Abbildung 7. Links: Gelbhalsmaus
Apodemus flavicollis
. – Foto: J.
L
indsey
. Rechts: Rötelmaus
Myodes glareolus
.
– Foto: S.
Y
eliseev
.








