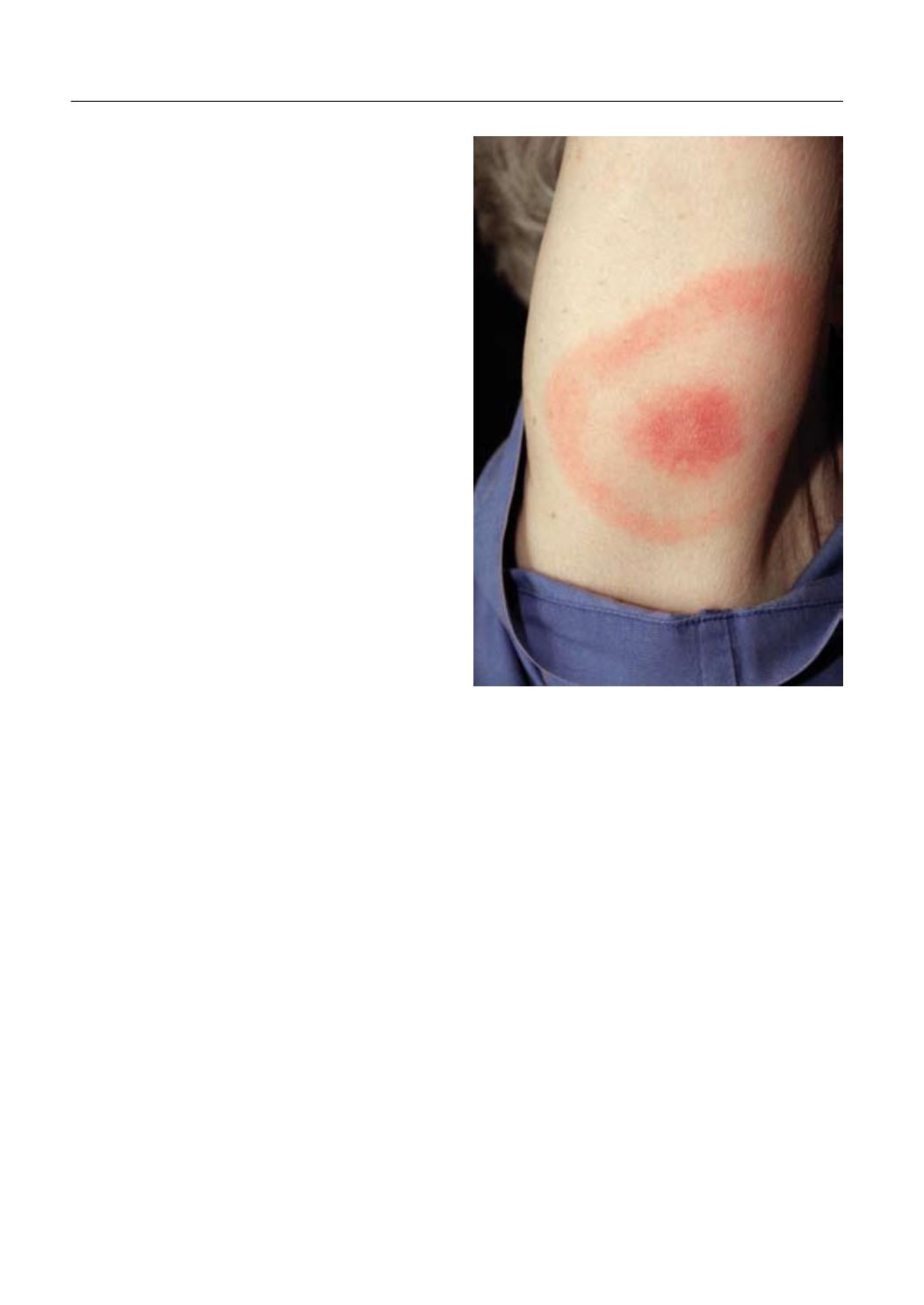
78
Carolinea 71
(2013)
3.7 Bezug zum Menschen
Menschlicher Kontakt zu Zecken steht in direkter
Verbindung mit der Aktivität des Menschen in
Gebieten, die von Zecken und deren Wirten be-
wohnt sind. Die Wahrscheinlichkeit, von
Ixodes
ricinus
gestochen zu werden und sich dabei
z.B. mit Borrelien zu infizieren, hängt – wie be-
reits dargestellt und diskutiert – vom Klima, dem
Landschaftstyp, der dort vorherrschenden Bio-
diversität und anderen Faktoren ab. Das Risiko
eines Zeckenstichs ist somit orts- und zeitabhän-
gig (spatiotemporal).
Es gibt keine Studien darüber, dass sich die
Fortbewegungsgeschwindigkeit von Menschen
auf die Wahrscheinlichkeit, von Zecken befallen
zu werden, auswirkt. Wie bereits erwähnt, sind
die wichtigen Stimuli eher Geruch und Erschüt-
terung. Der Übergang auf einen Wirt ist ein auto-
matischer Vorgang. Die Art, wie sich Menschen
im Habitat verhalten, und die Art der Aktivität
(z.B.Wandern, Pilze sammeln, Arbeiten imWald)
spielen dennoch eine wichtige Rolle in Bezug
auf das Risiko, der Wirt einer Zecke zu werden,
und im Hinblick auf die Übertragungsdynamik
verschiedener zeckenübertragener Krankheiten
(
S
toddard
et al. 2009). So sind Waldarbeiter und
Jäger eher abseits der Wege im Unterholz un-
terwegs, wo Zecken vorhanden sind, als eher
häuslich orientierte Menschen oder solche, die
in innerstädtischen Gebieten wohnen (
R
ath
et al.
1996,
F
ingerle
et al. 1997).
3.7.1 Wichtige humanpathogene
zeckenübertragene Krankheiten in
Baden-Württemberg
Borreliose
Borreliose ist in der nördlichen Hemisphäre nach
aktuellem Kenntnisstand die häufigste durch Ze-
cken übertragene Infektionskrankheit (
A
lpers
et
al. 2004,
S
tanek
2005,
P
oggensee
et al. 2008).
Sie ist als Multisystemerkrankung, die Haut,
Herz, Nervensystem, Muskel- und Skelettsystem
betreffen kann (
S
tanek
2005), gekennzeichnet
durch ein Spektrum unterschiedlicher klinischer
Manifestationen und Krankheitsbilder, verläuft
aber in mehr als 25 % der Fälle klinisch unauf-
fällig (
K
rause
&
F
ingerle
2009). Ein frühes Anzei-
chen der Infektion ist die Wanderröte (Erythema
migrans
,
EM, Abb. 10), eine lokale, meist kreis-
förmige Hautrötung. Abgesehen vom EM, das
einer späten Manifestation vorausgehen kann,
aber nicht muss, zeigen die meisten der chro-
nisch erkrankten Patienten nur Symptome an
einem Organsystem (
H
uppertz
et al. 1999), denn
die humanpathogenen Genospezies scheinen
jeweils bestimmte Organsysteme zu befallen.
Diese unterschiedlichen Organmanifestationen
führt man auch auf die Heterogenität des
Bor-
relia-burgdorferi
-s.l.-Komplexes zurück. So wird
Borrelia afzelii
häufig bei Hautmanifestationen
und
Borrelia garinii
bei Neuroborreliosen nach-
gewiesen.
Borrelia burgdorferi
s.s. wird vermehrt
bei
Arthritiden
(Gelenkentzündungen) nach-
gewiesen, die aber offensichtlich von allen drei
Spezies hervorgerufen werden können (
E
iffert
et al. 1998,
W
ang
et al. 1999,
L
uenemann
et al.
2001).
Durch eine rechtzeitige Diagnose und frühe
Therapie des EM können Spätfolgen der Lyme-
Borreliose, wie eine Neuroborreliose oder eine
Arthritis, meist verhindert werden. Andere chro-
nische Manifestationen, wie die Hautkrankheit
Abbildung 10. Charakteristischer Hautausschlag (Wan-
derröte, Erythema migrans) bei einer Lyme-Borreliose.
– Foto: J.
G
athany
.








